Unendliche Glut
Wie findet man die Kraft zum Widerstand, wenn das eigene Land seit fast drei Jahren militärisch angegriffen wird, die Invasoren auf dem Vormarsch sind und man sich allein gelassen fühlt? Um herauszufinden, wie es um die Gedanken und Gefühle der Ukrainer steht, reisten wir kurz vor Wintereinbruch zwei Wochen lang durch das Land. Wir trafen dort auf Not und Verzweiflung, aber auch auf eine außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit.
„Hier kommen Sie nie wieder raus“, sagt ein zehnjähriger blonder Junge, der neben mir in dem Bus sitzt, der gerade die Grenze zur Ukraine passiert hat. Seine Mutter versucht, die Sorgen beiseitezuwischen. Seit Februar 2022 darf kein Mann im Alter zwischen 18 und 60 Jahren das Land verlassen. Der Junge versteht nicht, dass ich Franzose bin und zwei Wochen später problemlos wieder ausreisen kann. Ein Land zu durchqueren, in dem ein totaler Krieg herrscht, bedeutet, mit Erschöpfung, Schmerz und Leidenschaftlichkeit, aber auch mit Missverständnissen und Schuldgefühlen konfrontiert zu werden. Das ist auch der Grund, warum ich hergekommen bin, um die Gefühlslagen der Ukrainer nach tausend Tagen Invasion zu verstehen und ihre Analysen zu hören. Ich komme zum ungünstigsten Zeitpunkt. Die Lage an der Front verschlechtert sich. Die Bombardierungen nehmen zu und versetzen die Bevölkerung in Angst und Schrecken. Was die internationale politische Lage betrifft, so gibt sie keinen Anlass zu Optimismus. Was sind die inneren Ressourcen der Ukrainerinnen und Ukrainer, die ihnen ermöglichen, weiter durchzuhalten?
Lwiw: Energie überall
Diese widersprüchlichen Gefühle erlebe ich in der westlichsten Stadt des Landes. Die Schulferien haben gerade begonnen. Hunderte von Teenagern laufen durch die Fußgängerzone mit ihren überfüllten Cafés. Sie wurden in diese Stadt geschickt, die den massiven Bombenangriffen entgangen ist, um eine Verschnaufpause einzulegen. Doch die Statuen sind verhüllt und die Fenster der Kirchen mit Brettern verkleidet. Die Restaurants schließen wegen der Ausgangssperre früh. Lwiw, das tausend Kilometer von der Front entfernt liegt, ist dennoch nicht verschont geblieben. Anfang September schlug eine Rakete im Stadtzentrum ein. Ein Mann verlor seine Frau und seine drei Töchter im Alter von 21, 18 und 7 Jahren. Die Philosophin Orysya Bila führt mich zum Friedhof der Stadt. Auf einem großen Gelände am Hang werden hier die Soldaten begraben. Gräber, so weit das Auge reicht. Sie bleibt vor jenen ihrer Schüler stehen und erzählt mir von ihnen. Ein weiteres Grab ist das von Natalia Boyko, einer 35-jährigen Lehrerin, die in den Krieg gezogen war. Sie wurde am 17. Oktober letzten Jahres getötet. Ein kleines Mädchen steht regungslos da: Es ist eine ihrer Schülerinnen. Alle weinen still vor sich hin. Orysya fällt es schwer hierherzukommen. „Hier konzentriert sich so viel Schmerz“, seufzt sie.
Philosophie Magazin +

Testen Sie Philosophie Magazin +
mit einem Digitalabo 4 Wochen kostenlos
oder geben Sie Ihre Abonummer ein
- Zugriff auf alle PhiloMagazin+ Inhalte
- Jederzeit kündbar
- Im Printabo inklusive
Sie sind bereits Abonnent/in?
Hier anmelden
Sie sind registriert und wollen uns testen?
Probeabo
Weitere Artikel
Die neue Sonderausgabe: Der unendliche Kafka
Auch hundert Jahre nach seinem Tod beschäftigt und berührt Franz Kafka. Fast unendlich erscheint der Interpretationsraum, den sein Werk eröffnet.
Der philosophischen Nachwelt hat Kafka einen Schatz hinterlassen. Von Walter Benjamin und Theodor Adorno über Hannah Arendt und Albert Camus bis hin zu Giorgio Agamben, Gilles Deleuze und Judith Butler ist Kafka eine zentrale Referenz der Philosophie. Überlädt man ihn damit zu Unrecht mit posthumen Deutungen? Vielleicht. Sein Werk lässt sich aber auch als Einladung lesen, seine Rätselwelt zu ergründen und im Denken dort anzuknüpfen, wo er die Tür weit offen gelassen hat.
Hier geht's zur umfangreichen Heftvorschau!
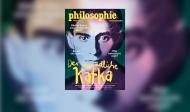
Kann uns die Liebe retten?
Der Markt der Gefühle hat Konjunktur. Allen voran das Geschäft des Onlinedatings, welches hierzulande mit 8,4 Millionen aktiven Nutzern jährlich über 200 Millionen Euro umsetzt. Doch nicht nur dort. Schaltet man etwa das Radio ein, ist es kein Zufall, direkt auf einen Lovesong zu stoßen. Von den 2016 in Deutschland zehn meistverkauften Hits handeln sechs von der Liebe. Ähnlich verhält es sich in den sozialen Netzwerken. Obwohl diese mittlerweile als Echokammern des Hasses gelten, strotzt beispielsweise Facebook nur so von „Visual-Statement“-Seiten, deren meist liebeskitschige Spruchbildchen Hunderttausende Male geteilt werden. Allein die Seite „Liebes Sprüche“, von der es zig Ableger gibt, hat dort über 200 000 Follower. Und wem das noch nicht reicht, der kann sich eine Liebesbotschaft auch ins Zimmer stellen. „All you need is love“, den Titel des berühmten Beatles-Songs, gibt es beispielsweise auch als Poster, Wandtattoo, Küchenschild oder Kaffeetasse zu kaufen.
Großmacht oder Beute? Vom Persischen Reich zum Iran
Träumt der Iran, der am Wochenende Israel angegriffen hat, davon, an die Hegemonie des Persischen Reiches im Nahen Osten anzuknüpfen? Antworten auf diese Frage finden sich in der langen Geschichte. Sie zeigt: Das Land neigt zur Expansion – ist aber auch immer wieder Opfer von Invasionen gewesen.

Sadik al Azm: „Syrien erlebt die Revolution in der Revolution“
Seit fast sechs Jahren wütet in Syrien ein brutaler Bürgerkrieg, in dem bis zu 500 000 Menschen getötet wurden, während Millionen zur Flucht innerhalb und außerhalb des Landes gezwungen wurden. Das Regime von Baschar al Assad und eine unübersichtliche Mischung von oppositionellen Kräften und IS-Milizionären bekämpfen einander und die Zivilbevölkerung rücksichtslos. Vor vier Jahren sprach das Philosophie Magazin mit Sadik al Azm, einem der bedeutendsten Philosophen des Landes, der kurz zuvor nach Deutschland emigriert war, über die Aussichten für Syrien, das Gespräch führte Michael Hesse. Al Azm ist am Sonntag, dem 11. Dezember 2016, in Berlin gestorben.

Elite, das heißt zu Deutsch: „Auslese“
Zur Elite zählen nur die Besten. Die, die über sich selbst hinausgehen, ihre einzigartige Persönlichkeit durch unnachgiebige Anstrengung entwickeln und die Massen vor populistischer Verführung schützen. So zumindest meinte der spanische Philosoph José Ortega y Gasset (1883–1955) nur wenige Jahre vor der Machtübernahme Adolf Hitlers. In seinem 1929 erschienenen Hauptwerk „Der Aufstand der Massen“ entwarf der Denker das Ideal einer führungsstarken Elite, die ihren Ursprung nicht in einer höheren Herkunft findet, sondern sich allein durch Leistung hervorbringt und die Fähigkeit besitzt, die Gefahren der kommunikationsbedingten „Vermassung“ zu bannen. Ortega y Gasset, so viel ist klar, glaubte nicht an die Masse. Glaubte nicht an die revolutionäre Kraft des Proletariats – und wusste dabei die philosophische Tradition von Platon bis Nietzsche klar hinter sich. Woran er allein glaubte, war eine exzellente Minderheit, die den Massenmenschen in seiner Durchschnittlichkeit, seiner Intoleranz, seinem Opportunismus, seiner inneren Schwäche klug zu führen versteht.
Was macht Fußball schön?
In Frankreich findet in diesen Wochen die Fußball-Europameisterschaft statt, mit der die populärste Sportart unserer Zeit breite Schichten des Kontinents fasziniert. Doch worin liegt die besondere ästhetische, spielerische und emotionale Attraktivität des Spieles? Man mag es kaum noch glauben. Aber es gab auch eine Welt ohne Fußball. In weniger als 150 Jahren eroberte ein Freizeitvergnügen für englische Internatsschüler den gesamten Erdball. Heute wirkt es als globales Medium der Völkerverständigung, ist Zentrum nationaler Selbstverständnisse, bildet den Lebensinhalt ganzer Familien. Auf der phil.cologne 2013 drangen Volker Finke und Gunter Gebauer gemeinsam in die Tiefen des Spiels vor und legten für uns die verborgenen Schönheiten des „simple game“ frei. Der langjährige Bundesligatrainer Finke und der Sportphilosoph Gebauer im Dialog über die Ästhetik des Kurzpasses, androgyne Helden und die falsche Dogmatik des Jogi Löw.

Und woran zweifelst du?
Wahrscheinlich geht es Ihnen derzeit ähnlich. Fast täglich muss ich mir aufs Neue eingestehen, wie viel Falsches ich die letzten Jahre für wahr und absolut unumstößlich gehalten habe. Und wie zweifelhaft mir deshalb nun alle Annahmen geworden sind, die auf diesem Fundament aufbauten. Niemand, dessen Urteilskraft ich traute, hat den Brexit ernsthaft für möglich gehalten. Niemand die Wahl Donald Trumps. Und hätte mir ein kundiger Freund vor nur zwei Jahren prophezeit, dass im Frühjahr 2017 der Fortbestand der USA als liberaler Rechtsstaat ebenso ernsthaft infrage steht wie die Zukunft der EU, ich hätte ihn als unheilbaren Apokalyptiker belächelt. Auf die Frage, woran ich derzeit am meisten zweifle, vermag ich deshalb nur eine ehrliche Antwort zu geben: Ich zweifle an mir selbst. Nicht zuletzt frage ich mich, ob die wundersam stabile Weltordnung, in der ich als Westeuropäer meine gesamte bisherige Lebenszeit verbringen durfte, sich nicht nur als kurze Traumepisode erweisen könnte, aus der wir nun alle gemeinsam schmerzhaft erwachen müssen. Es sind Zweifel, die mich tief verunsichern. Nur allzu gern wüsste ich sie durch eindeutige Fakten, klärende Methoden oder auch nur glaubhafte Verheißungen zu befrieden.
Wie treffe ich eine gute Entscheidung?
Seit jeher haben Menschen Entscheidungsprobleme. Was sich bereits daran zeigt, dass eine der wichtigsten Institutionen der Antike eine Art göttliche Beratungsagentur darstellte. Sagenumwobene Orakel, deren meistfrequentierte Filiale sich in Delphi befand und dort mit dem Slogan „Erkenne dich selbst“ um weisungswillige Griechen warb, stillten nicht nur religiöse, sondern auch politische, militärische und lebenstherapeutische Informationsbedürfnisse. In wirtschaftlicher Hinsicht funktionierten Orakel gar wie moderne Consulting-Buden. Wer genug Drachmen hatte, konnte eine ausführliche Interpretation der Weissagungen durch die prophetische Priesterin Pythia erhalten, während weniger Begüterte lediglich Ja- oder Nein-Fragen stellen durften.