Abschied von Mittelerde
Max Weber beschrieb die Moderne als Zeit der „Entzauberung“. Dabei handelt es sich jedoch weniger um eine präzise theoretische Diagnose als um ein schwer fassbares Verlustgefühl. Der Herr der Ringe erzählt – ähnlich wie die Sagen um Avalon – die Geschichte dieser Melancholie.
Jeder Sieg hat seinen Preis und wo etwas gewonnen wird, geht auch etwas verloren. Diese Vorstellung eines Gleichgewichts, das aus dem Lot gerät und wiederhergestellt wird, bildet die Struktur vieler Mythen und liegt auch Narrativen zugrunde, die vom Ende der Welt des Mythos und dem Beginn einer „modernen“ Welt erzählen.Der Herr der Ringe lässt sich zwar nicht komplett auf ein solches Narrativ reduzieren, doch teilweise folgt das Buch diesem Muster. Nach Tolkiens Vorstellung sollte das gewaltige Epos uns das Leben, aber auch das Sterben einer Welt vor Augen führen, in der sich schließlich die menschliche Kreatur als die mittelmäßigste von allen durchsetzt – einer Welt, aus der die mythischen Geschöpfe, vor allem die Elben, verschwanden. Am Ende des Romans – sieht man von den Anhängen ab – ist die neue Welt also „entzaubert“.
Wohin genau begibt sich Frodo, nachdem die Mission des Rings beendet und Sauron besiegt ist? Nach Valinor, ein Gebiet, in das sich auch die Elben zurückziehen. Es ist der Zufluchtsort der Helden, Zauberer und magischen Geschöpfe in einer Zeit, in der der Mensch endgültig von Ländern Besitz ergreift, die er sich vormals mit verschiedenen Völkern fabelhafter Wesen teilte, Ländern, wo einst die Magie regierte, eine handwerkliche Produktionsweise vorherrschte und man ritterliche Werte wie Mut und Selbstlosigkeit noch hoch schätzte.
Viele Interpreten halten dieses Land Valinor für eine Spielart der mythischen Insel Avalon. Die Artussage, die zur Legendensammlung der sogenannten Matière de Bretagne gehört, behandelt sowohl die Hochphase der keltischen Mythologie als auch deren Niedergang. Ausgehend von der heidnischen Naturverehrung erzählt sie, wie diese aufgegeben und durch andere Wertesysteme ersetzt wird. Bei diesem melancholischen Abschied von vorchristlichen Glaubensvorstellungen spielt die Insel Avalon eine wesentliche Rolle: Seit der Darstellung in Geoffrey von Monmouths Historia Regum Britanniae ist die Insula Avallonis der Ort, an den der verletzte König Artus von Feen gebracht wird, um dort geheilt zu werden (oder friedlich zu sterben).
Schwindender Zauber
Philosophie Magazin +

Testen Sie Philosophie Magazin +
mit einem Digitalabo 4 Wochen kostenlos
oder geben Sie Ihre Abonummer ein
- Zugriff auf alle PhiloMagazin+ Inhalte
- Jederzeit kündbar
- Im Printabo inklusive
Sie sind bereits Abonnent/in?
Hier anmelden
Sie sind registriert und wollen uns testen?
Probeabo
Weitere Artikel
Philosophie der Zwischenräume
Was ist Musik? Worin sah Vladimir Jankélévitch ihr Unaussprechliches? Und wie dachte Ludwig Wittgenstein über Harmonik nach? Drei Bücher suchen nach einer Sprache für schwer fassbare Phänomene.

Das zerstreute Ich
Unser Alltag wird zunehmend von Unterbrechungen und Multiasking bestimmt. Im Dauerfeuer der medialen reize fällt es immer schwerer, auch nur einen einzigen klaren Gedanken zu fassen. Die anzahl der ADHS-Diagnosen steigt ebenso kontinuierlich an wie jene der burnout-Diagnosen. Sind die fliehkräfte des digitalen Kapitalismus im begriff, neben dem alltag auch unser Innerstes zu zerreißen? Doch was wissen wir eigentlich über die wahre Gestalt des menschlichen bewusstseins? Ist unser Denken womöglich von Natur auf permanente zerstreuung angelegt? Stellt das dezentrierte Ich sogar utopische Perspektiven einer neuen, intensiveren Daseinsform in aussicht?
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so mütend bin
Um die pandemische Grundstimmung auf den Punkt zu bringen, sind neue Wörter entstanden: „mütend“ im Deutschen, „languishing“ im Englischen. Beide weisen Ähnlichkeiten zu einem Gefühl auf, mit der die Philosophie sich immer wieder beschäftigte: die Melancholie.

Eva Weber-Guskar: „Chatbots können zu einer Vermischung von Fiktion und Realität führen“
Künstliche Intelligenz erhält Einzug in unsere Gefühlswelt. Dabei stellen sich nicht nur technische, sondern auch moralische wie gefühlstheoretische Fragen. Mit ihrem neuen Buch stellt die Philosophin Eva Weber-Guskar die Frage: Welche Zukunft wollen wir?

Gottlob Frege und die Sprache
Gottlob Frege, dessen Todestag sich am 28. Juli 2025 zum 100. Mal jährte, gilt als Wegbereiter der analytischen Philosophie: jener Strömung, die sich von metaphysischer Spekulation abwandte und nach einer präzisen, an die Mathematik erinnernden Sprache suchte. Was hat uns Frege über Funktionsweise und Fallstricke der Sprache zu sagen?
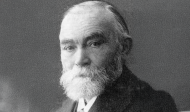
Andreas Weber: „Ein Kompromiss ist ein wilder Friede“
Kompromisse haben einen schlechten Ruf. Sofort wittert man Übervorteilung und Betrug. Eine ganz falsche Sichtweise meint der Philosoph Andreas Weber in seinem jüngst erschienenen Buch „Warum Kompromisse schließen?“. Im Gespräch erläutert er, warum wir diese Form der Übereinkunft als Ausweis unserer Menschlichkeit schlechthin betrachten sollten.

Am Abgrund der Moderne
Hannah Arendt hat nicht nur die totalitäre Herrschaft analysiert, sondern auch die Traditionsbrüche beschrieben, die diese ermöglichte. Traditionsbrüche, die auch in Arendts eigenem Leben und Arbeiten Spuren hinterließen – und sie sehr sensibel für jegliche Gefahren in Demokratien machten. Was können wir heute noch in der Auseinandersetzung mit Arendts Arbeiten lernen? Ein Interview mit der Gründerin des Hannah Arendt-Zentrums Antonia Grunenberg.

Andreas Weber: „Wir sollten in Freundschaft zu allem Lebenden existieren“
Ist es möglich, mit Tieren oder gar Pflanzen befreundet zu sein? Ja, meint der Biologe, Philosoph und Publizist Andreas Weber. Ein Gespräch über nichtmenschliche Gefährten und die Frage, ob man seine Freunde essen darf.
