Edmund Burke und der Staat
Edmund Burke übte scharfe Kritik an der Französischen Revolution, da in der „abstrakten Vollkommenheit“ von Staaten ihre „praktische Untauglichkeit“ läge. Was damit gemeint ist? Wir helfen weiter.
Das Zitat
„Staaten sind nicht gemacht, um natürliche Rechte einzuführen, die in völliger Unabhängigkeit von allen Staaten existieren können und wirklich existieren und in viel größerer Klarheit und in einem weit höheren Grade abstrakter Vollkommenheit existieren. Aber eben in ihrer abstrakten Vollkommenheit liegt ihre praktische Unzulänglichkeit. Solange der Mensch ein Recht auf alles hat, mangelt es ihm an allem.“
Betrachtungen über die Französische Revolution (1790)
Die Relevanz
Welche unveräußerlichen Rechte stehen jedem Menschen zu? Seit der ersten Erklärung der Menschenrechte durch den persischen Herrscher Kyros im Jahr 538 v. Chr. durchzieht diese Frage die Geschichte des Denkens. In der Aufklärung wurde sie besonders vehement diskutiert, wie nicht zuletzt die Bill of Rights der US-amerikanischen Gründerväter und die Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen der französischen Revolution belegen. Unter jenen Stimmen, die derlei Erklärungen mit Skepsis begegneten, ist die des irisch-britischen Philosophen Edmund Burkes die wohl bekannteste. Mit ihm lassen sich insbesondere zwei kritische Fragen von unverkennbarer Aktualität stellen. Erstens: Wo liegt der Unterschied zwischen ‚universellem Recht‘ und ‚individuellem Anspruch‘, wie er etwa in der jüngsten Wahlkampf-Debatte um ein ‚Recht auf Urlaubsflüge‘ durchschimmert? Zweitens: Inwiefern sind einzelne historisch und territorial begrenzte Staaten und Staatengemeinschaften dazu befugt, sich allgemeingültige Rechte auf die Fahne einer politischen Agenda zu schreiben? Eine Frage, die vor dem Hintergrund des jüngsten NATO-Abzuges aus Afghanistan eine moralisch-politische Brisanz besitzt.
Die Erklärung
Während sich Zeitgenossen wie Georg Forster und Immanuel Kant von der Französischen Revolution erst abwandten, als Schauprozesse und Guillotinierungen Alltag wurden, war Burkes Ablehnung von Anfang an prinzipieller Natur. Der konservative Denker zeigte sich überzeugt: Nationalstaaten lassen sich nicht auf philosophischen Überzeugungen gründen. Vielmehr erwachsen sie allmählich aus dem Nährboden tradierter Werte, repräsentierender Institutionen und einem Gefühl kollektiver Zugehörigkeit. Es liegt daher im Wesen eines Staates, dass er erstens nicht vollkommen ist, denn so organisch er gewachsen ist, so organisch wird er sein Antlitz auch in Zukunft verändern. Zweitens kann eine Nation weder in ihrem politischen Agieren noch in ihrer inneren Verfasstheit den berechtigten Anspruch erheben, die Menschheit in ihrer Universalität zu repräsentieren. Ein Staat fußt auf dem Vermächtnis der Ahnen und nicht auf philosophischen Abstraktionen. Der Anschluss an die historisch gewachsenen Strukturen einer Gesellschaft ist nach Burke die Voraussetzung für jede auch noch so grundlegende Rechtsgeltung. Deswegen verlieren die universell-menschlichen Rechte der französischen Nationalversammlung gerade durch ihre geschichtslose Universalität ihre Gültigkeit. Statt zur Stabilität der Gesellschaft beizutragen, öffnen sie dem politischen Missbrauch Tür und Tor und suggerieren kollektive Ansprüche, die individuell nie zur Deckung gelangen können. Denn: Ein totales Versprechen findet nie seine Einlösung. •
Weitere Artikel
Edmund Burke und der Staat
Edmund Burke übte scharfe Kritik an der Französischen Revolution, da in der „abstrakten Vollkommenheit“ von Staaten ihre „praktische Untauglichkeit“ läge. Was damit gemeint ist? Wir helfen weiter.

Edmund Husserl und der Eigenleib
Der Begründer der Phänomenologie, Edmund Husserl, schreibt, unser „Eigenleib“ sei „Zentralglied der dinglichen Umgebungsauffassung“. Was meint er damit?

Syndemie: Die Krankheit vor der Krankheit?
In der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet war unlängst zu lesen, dass wir gerade keine Pandemie, sondern vielmehr eine Syndemie erleben. Um zu verstehen, was damit gemeint ist und welche Konsequenzen das hat, hilft ein Blick in das Werk des französischen Arztes und Philosophen Georges Canguilhem.

Catherine Malabou: „Kryptowährungen stellen die Idee des Staates infrage“
Die chinesische Zentralbank hat Mitte September ihr Vorhaben bekräftigt, einen digitalen Yuan einzuführen. Das ist nur eines von vielen Beispielen für den zunehmenden Willen von Staaten, auf dem Gebiet der Kryptowährungen mitzuhalten – die Philippinen, Schweden, Uruguay, Mexiko und selbst die Eurozone verfolgen ähnliche Projekte. Für die Philosophin Catherine Malabou ist dies ein Widerspruch in sich, da Kryptowährungen auf anarchistischen Prinzipien von Horizontalität und Dezentralisierung beruhen, die die Währungshoheit von Staaten und Zentralbanken infrage stellen.

Élisabeth Badinter: "Wir müssen dem Fanatismus die Stirn bieten"
Im Frühling dieses Jahres, nach den Anschlägen von Paris im November, aber vor dem Attentat am Französischen Nationalfeiertag in Nizza, sprach das Philosophie Magazin mit der Philosophin Élisabeth Badinter über die Bedeutung, die fundamentalistischer Terror für laizistische und demokratische Staaten hat und wie sie damit umgehen können und sollten. Badinter ist Feministin und bedingungslose Anwältin einer strikten Trennung von Kirche und Staat. In der Konfrontation mit der Rückkehr des Fanatismus appelliert sie mit Nachdruck an die Kraft der Vernunft.

Die Revolution geht weiter
Seit der dritte Stand 1789 die Bühne betreten hat, ist alle Geschichte die Geschichte von Verfeinerungskämpfen der Französischen Revolution. Sie werden darum geführt, welche Form die freigesetzten demokratischen Energien bekommen. Drei Konflikte stehen dabei im Mittelpunkt.
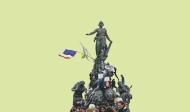
Fehlgeleitete Kritik aus Berlin
In einem „Brief aus Berlin“ kritisieren Wissenschaftler die Reaktion der Bundesregierung auf den Nahostkonflikt und den Umgang der Berliner Regierung mit Demonstranten. Die Kritik sei jedoch zu undifferenziert und tatsachenverzerrend, so Christian Thein in einem Gastbeitrag.

Einbruch des Realen
Warum hielten trotz jahrelanger Drohungen so viele eine russische Invasion der Ukraine für unwahrscheinlich? Weil wir alternative Szenarien bevorzugen, um dem Realen zu entfliehen, meint Alexandre Lacroix, Chefredakteur des französischen Philosophie Magazine. Zeit, das Undenkbare anzunehmen.
