Fiktion und Wirklichkeit
Für radikale Perspektivwechsel braucht es neue Wörter. Dafür führt Donna Haraway Begriffe ein, die die Welt nicht nur besser erfassen sollen, sondern auch utopische Kraft haben.
Situiertes Wissen
Der Begriff des „situierten Wissens“ ist das Ergebnis von Haraways Bemühen um ein neues, feministisches Verständnis von wissenschaftlicher Erkenntnis. Die Kontrastfolie bildet die verbreitete Vorstellung einer standpunktunabhängigen Objektivität: Ihr zufolge hat Wissen einen überzeitlichen, orts- und körperlosen Charakter; der Wissensgegenstand lässt sich gleichsam „von überall und nirgends“ betrachten und vollständig erfassen. Haraway bezeichnet dies als „göttlichen Trick“, es wird suggeriert, Wissenschaftler könnten eine quasigöttliche Position einnehmen. In Wirklichkeit, so Haraway, bestehe dieses vermeintlich objektive Wissen lediglich in der Sichtweise der herrschenden Gruppe weißer Männer. Der Begriff des „situierten Wissens“ betont demgegenüber, dass Wissen grundsätzlich „partial“ sei – partiell und parteiisch. Es ist an einen Ort, einen Körper und eine soziale Position gebunden. Zudem stimmt Haraway mit anderen Feministinnen darin überein, dass die „Sicht von unten“, die Perspektive benachteiligter Gruppen, besser sei als die „von oben“, da sie Herrschaftsverhältnisse klarer erkenne. Haraway warnt allerdings auch vor den Risiken der von ihr skizzierten Wissenskonzeption: Sie dürfe weder zu einer Verabsolutierung und Verhärtung des Standpunkts der Unterworfenen führen noch zu einem Relativismus, für den alle Sichtweisen gleich gültig sind. Beide Gefahren haben sich inzwischen – denkt man an manche Formen der Identitätspolitik und den Trumpismus – als sehr real erwiesen.
Philosophie Magazin +

Testen Sie Philosophie Magazin +
mit einem Digitalabo 4 Wochen kostenlos
oder geben Sie Ihre Abonummer ein
- Zugriff auf alle PhiloMagazin+ Inhalte
- Jederzeit kündbar
- Im Printabo inklusive
Sie sind bereits Abonnent/in?
Hier anmelden
Sie sind registriert und wollen uns testen?
Probeabo
Weitere Artikel
Donna Haraway: „Wir müssen lernen, mit dem Mehr-als-Menschlichen in Kontakt zu treten“
Donna Haraway inspirierte Generationen dazu, neue, kreative Arten der Koexistenz von Mensch, Natur und Technik zu entwerfen. Ihr Denken bewegt sich zwischen Thomas von Aquin, Science-Fiction und Hundetraining. Eine Begegnung unter Bäumen.
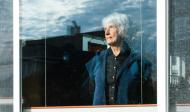
Donna Haraway: „Wir müssen lernen, mit dem Mehr-als-Menschlichen in Kontakt zu treten“
Donna Haraway ist eine der einflussreichsten und innovativsten Philosophinnen unserer Zeit. Ihr feministisch-ökologisches Denken bewegt sich zwischen Thomas von Aquin, Evolutionstheorie, Science-Fiction und Hundetraining. Eine Begegnung unter Bäumen.

Anna Tsing: „Bei Plantagen handelt es sich um ein ganzes System der Entfremdung, das bis zu unserem modernen Kapitalismus geführt hat”
Die Anthropologin Anna Tsing feierte mit ihrem Essay Der Pilz am Ende der Welt große Erfolge. Gemeinsam mit Donna Haraway entwickelte sie den Begriff „Plantationozän” und zeigt in ihrem aktuellen Buch die Verwobenheit von Mensch und Natur auf.

Kompost statt Grabstätte
Sterbliche Überreste, die zu Erde werden und im Blumentopf landen? Was ungewöhnlich klingt, ist nun auch im Bundesstaat New York legalisiert worden: „Human Composting“. Warum wir lernen müssen, den Menschen als Humus zu begreifen, weiß die Philosophin Donna Haraway.

Ferien vom Realitätsprinzip: „Die Durrells auf Korfu“
Die Serie Die Durrells auf Korfu ist derzeit in der Arte-Mediathek zu sehen. Mit sprühendem Witz erzählt sie vom Leben der exzentrischen Familie auf der griechischen Insel. Dabei scheint eine undogmatische Form des Utopischen auf.

Amélie Poinssot: „Viktor Orbán spielt ein Doppelspiel“
Machiavellist, Demagoge oder doch nur Populist? Viktor Orbán ist schwer zu erfassen. Im Gespräch erläutert Amélie Poinssot den politischen Stil des ungarischen Premiers, der eine Vorliebe für autoritäre Regime hat, sich aber auch versöhnlich zeigen kann.

„Wir brauchen eine andere Art von Welterzählung“
Nature Writing ist eine literarische Gattung der poetisch-essayistischen Naturbeschreibung. Im Gespräch erläutert die Autorin und Herausgeberin Judith Schalansky, wie sich eine Welt, die jenseits der Worte existiert, sprachlich erfassen lässt, und weshalb das Genre genuin politisch ist.

Ludger Schwarte: „Farbe ist immer anarchisch“
Lange Zeit wurde die Farbe in der Philosophiegeschichte ausgeklammert. Ein Unding, wie Ludger Schwarte in seinem neuen Buch Denken in Farbe erläutert. Schließlich eignen wir uns die Welt nicht nur durch Farben an, sondern sie besitzen auch ein subversives Potenzial.
