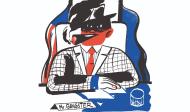Unsere Wahl
Sie brauchen neuen Lesestoff? Wir stellen Ihnen sechs philosophische Neuerscheinungen in Kurzrezensionen vor. Es geht unter anderem um den Sternenhimmel, den Ruhrpott und das neue Christentum.
Sternenhimmel
Wer dieses wunderbare Buch liest, wird sicher sein: Es gibt keinen besseren Kosmologen als Eliot Weinberger. Der amerikanische Essayist, der zuletzt mit einer Sammlung scharfsinniger politischer Texte über die USA begeistert hatte, ist zurück auf dem Feld der poetisch-philosophischen Weltbetrachtung. In „Die Sterne“ ziehen antike, fernöstliche und frei erfundene Denkbilder ihre Bahnen. Die Sterne sind „Liebesboten“ oder „Geist-Atem“, und „erzeugen eine Musik am Himmel“, heißt es in dieser Himmelskörperbeschreibungsliste, die man am liebsten komplett zitieren würde. „Ohne Sterne geht gar nichts“, hält Michael Krüger in seinem kongenial luziden Nachwort fest. Natürlich auch keine Philosophie! (Jutta Person)
Eliot Weinberger: Die Sterne Übers. v. Peter Torberg, Nachwort v. Michael Krüger, Illustrationen v. Franziska Neubert. Berenberg, 80 S., 18 €
Der Pott
Als Metropolenschreiber des Ruhrgebiets macht sich Wolfram Eilenberger ein Jahr lang auf die Suche nach einem klassischen „Nicht-Ort“ oder „U-Topos“, der erst von seiner Arbeitsform, dann von lang anhaltender Strukturschwäche geprägt schien. Vom zählebigen Mythos des Kumpels über Herbert Grönemeyers „Blume im Revier“ bis zu den Skulpturenparks in Duisburg: Der Philosoph, ehemaliger Chefredakteur und jetzt Kolumnist des Philosophie Magazins, fragt mit Simone Weil und Ralf Rothmann im Gepäck, was Identität überhaupt sein soll – und bringt Licht ins Kohledunkel. (red)
Wolfram Eilenberger: Das Ruhrgebiet. Versuch einer Liebeserklärung Tropen, 144 S., 16 €
Feminismus
Andrea Long Chus Essay Females. Alle sind weiblich formuliert zwei Thesen: „Alle Menschen sind weiblich. Und alle hassen es.“ Die amerikanische Autorin entwickelt ihre Gedanken entlang der Lektüre von Valerie Solanas’ Theaterstück Up your Ass, das möglicherweise der Anlass für Solanas’ Attentat auf Andy Warhol war: Sie wollte, dass er es inszenierte, er verschlampte das Manuskript. Einige Passagen des Theaterstücks finden sich in Solanas’ SCUM-Manifest wieder. Darin beschreibt sie Männer mit Verweis auf ihr verstümmeltes Y-Chromosom als „unvollständige Frauen“ und sieht die menschliche Geschichte als unterdrücktes Verlangen von Männern, ihre Weiblichkeit zu vervollständigen.
„Weiblich“ und „Frau“ sind für Long Chu und Solanas keine Bezeichnungen eines biologischen oder sozialen Geschlechts, sondern eine quasi ontologische Kategorie. Solanas hielt Frauen für dynamisch und bestimmend, Männer für eitel und schwach. An diesem entscheidenden Punkt weicht Long Chu von Solanas ab. Sie definiert jeden psychischen Vorgang als weiblich, „bei dem das Selbst aufgeopfert wird, um Platz für das Begehren einer anderen Person zu schaffen“. Long Chu gibt zu, dass dies eine „tendenziöse Definition“ sei; sie kritisiert Feminismus als Theorie der Ablehnung des Weiblichen. Dabei teilt sie doch offenkundig die alte feministische Überzeugung, dass unter dem Patriarchat alle leiden.
Long Chus Doppelthese erweist sich als widersprüchlich und ist dennoch produktiv: weil sie die Frage provoziert, ob es sich nicht auch ganz anders verhalten könnte. Wenn das Begehren, wie Long Chu schreibt, generell eine von außen wirkende Kraft ist, ließe sich auch umgekehrt denken: „Alle sind weiblich und lieben es.“ Die eine These ist so universalistisch wie die andere. Der Unterschied besteht in der Setzung, was es heißt, in der Welt zu sein: Sind wir bloß Opfer einer Struktur? Oder gilt es, sich als Handelnde zu begreifen, deren Autonomie paradoxerweise eben daraus erwächst, dass nichts und niemand mit sich selbst identisch ist? (Ulrich Gutmair)
Andrea Long: Chu Females. Alle sind weiblich Übers. v. Lea Sauer Merve, 112 S., 13 €
Kinderbuch
Manchmal schlägt man ein Buch auf und denkt, das ist ja meine Geschichte, woher kennt mich die Autorin? So kann es einem mit diesem Bilderbuch ergehen. Nur wenige Bilder und Fragen benötigt Johanna Schaible, um uns auf eine Reise von der Entstehung der Erde bis in die ferne Zukunft zu schicken. In ihren Bildern, die das Abstrakte und das Konkrete perfekt miteinander verbinden, zeigt sie mit großer Klarheit, dass Zeit im Grunde Raum ist.
Zugleich stellt sie den Lesenden Fragen über die Zukunft, deren Beantwortung viel über die Gegenwart aussagt. Die Welt wird auf jeder Doppelseite zu einer Landschaft, deren Erkundung uns das Leben näherbringt. Ein unglaubliches Buch ist der Schweizerin gelungen, das in die Hände jedes Grundschulkinds gehört. (Thomas Linden)
Johanna Schaible: Es war einmal und wird noch lange sein Hanser, 56 S., 18 €
Raum für alle
Zwei Zugreisende haben sich in ihrem Abteil ausgebreitet. Da kommen zwei neue Passagiere dazu. Sofort werden die beiden ersten zu denen, die „schon da“ waren. Widerwillig machen sie Platz frei. Die neuen fühlen sich nicht richtig wohl, zu klar ist, dass sie stören. Bis zwei weitere Mitreisende einsteigen. Jetzt werden diese zu Fremden. Selbst die beiden, die als Erste dazugekommen sind, empfinden sie als Eindringlinge.
Dabei sind alle sechs im Abteil, so die italienische Philosophin Donatella Di Cesare in ihrer Philosophie der Migration, keine Einheimischen. Auch die ersten beiden Passagiere sind nur „dazugekommen“. Was Di Cesare zu einem so provozierenden wie praktischen Begriff bringt: Wir alle sind höchstens „ansässige Fremde“. Auch wenn manche Familien schon länger irgendwo sind: Niemand, der an einem Ort lebt, war immer schon da. Wer das begreift, wird Neuankömmlingen mit Respekt gegenübertreten. Kein Raum ist unser Eigentum, schon gar nicht, wenn dieses „unser“ über so etwas Abstraktes wie „Nation“ definiert ist. Eindringlich beschäftigt sich Di Cesare mit Hannah Arendts berühmtem Essay Wir Flüchtlinge von 1943, in dem der Staat als struktureller Antipode des „Staatenlosen“ sichtbar wird.
Während der Staat für seine Bürger Menschenrechte und Ähnliches zu garantieren verpflichtet ist, neigt er dazu, Neuankömmlinge Nutzenkategorien zu unterwerfen. So wird er zum Verhinderer von Menschlichkeit gegenüber Migranten. Immer wieder spannend ist, wie Di Cesare, die gern als letzte persönliche Schülerin Heideggers gehandelt wird, ihren einstigen Mentor, oft kritisch, ins Spiel bringt. Diesmal entdeckt sie, die als unkonventionelle Linke politisiert, ihn als Vertreter einer „Ethik des Wohnens“. Denn „für Heidegger kann es weder Würde noch Menschlichkeit geben, es sei denn jener Aufenthalt wird gewahrt, in dessen Offenheit die Welt erst zum Vorschein kommt“. Mit Jacques Derrida plädiert Di Cesare für die Aufrechterhaltung des uralten Konzepts der „Gastfreundschaft“ – ausgehend von Heideggers „Heimatlosigkeit eines jeden“. (Hans-Peter Kunisch)
Donatella Di Cesare: Philosophie der Migration Übers. v. Daniel Creutz Matthes & Seitz, 400 S., 26 €
Neues vom Christentum
Jürgen Manemann zeigt, dass sich eine eingreifende Religiosität mitnichten in Kirchentags-Kumbaya und konservativem Kulturkampf erschöpft: Er verknüpft die Umwelt- und Demokratiekrise mit der Legitimitäts- und Glaubenskrise der Kirche und beklagt deren Verbürgerlichung, welche ihre eigentlich umstürzlerische Mission eines gerechteren Diesseits korrumpiere. Seine anregende Verbindung der fast vergessenen Neuen Politischen Theologie mit aktuellen philosophischen Entwürfen gerät zuweilen leider selbst zu wenig radikal: Das Folgeproblem einer fundamentalen Moralisierung der Welt bleibt ebenso ausgespart wie das des Transzendenzverlusts für die Religion. Dennoch ist Manemanns Aufruf zum Exodus eine flammende Erinnerung daran, warum die Philosophie einmal als Magd der Theologie galt. (Tilman Salomon)
Jürgen Manemann: Revolutionäres Christentum. Ein Plädoyer transcript, 160 S., 18 €
Weitere Artikel
Lesetipps
Sie brauchen neuen Lesestoff? Wir stellen Ihnen sechs philosophische Neuerscheinungen in Kurzrezensionen vor. Es geht unter anderem um Nietzsche, eine Katze im Wald und das gute Leben.

Lesetipps für den Herbst
Sie brauchen neuen Lesestoff? Wir stellen Ihnen sechs philosophische Neuerscheinungen in Kurzrezensionen vor. Es geht unter anderem um Stuttgart, Raubkunst und Degrowth.

Lesetipps für den Frühling
Sie brauchen neuen Lesestoff? Wir stellen Ihnen sieben philosophische Neuerscheinungen in Kurzrezensionen vor. Es geht unter anderem um Ekstase, Michel de Montaigne und den Kapitalismus.

Mein Schmerz - Sechs Berichte
Der Umgang mit schwerer Schuld gehört zu den größten Herausforderungen der Existenz. Sechs Menschen berichten. Kommentiert von Fabian Bernhardt.
Jetzt bist du gefragt! - Sechs Urszenen
Auf der Welt zu sein bedeutet, in der Verantwortung zu stehen: für das eigene Selbst, nächste Verwandte wie auch wildfremde Menschen. Sechs Urszenen, die zeigen, was das im Alltag bedeuten kann.
Der bestirnte Himmel über mir, der blaue Planet unter mir
Kant hatte beim Blick in den Sternenhimmel erhabene Gefühle. Seit 50 Jahren wird zurückgeblickt. Aus dem All sieht man besser, was es mit unserem Heimatplaneten auf sich hat: Wir brauchen die Erde, sie braucht uns nicht.

Wenn die Brandmauer fällt
Der Wahlsieg von Geert Wilders ist Ausdruck eines allgemeinen Rechtsruck, der durch Europa geht. Er verdeutlicht, dass zusehends Demokratie und Populismus miteinander gleichgesetzt werden – mit dramatischen Folgen. Ein Beitrag von Josef Früchtl.

Warum wir Gangster wählen
Dass Donald Trump vor Gericht steht, steigert seine Chancen auf den Wahlsieg. Wer sich darüber wundert, übersieht, dass das Recht seine Würde längst eingebüßt hat, meint Eva von Redecker.