Was schulden wir unseren Eltern?
Im Idealfall bekommen Kinder von ihren Eltern Liebe und Fürsorge. Stehen sie deshalb aber auch in ihrer Schuld? Drei philosophische Perspektiven auf das intergenerationelle Verhältnis.
„Mehr als wir jemals geben können“
Aristoteles (384-322 v. Chr.)
Wer einen Kredit aufnimmt, der ist in der Bringschuld: Er verpflichtet sich, zu einem vereinbarten Zeitpunkt den geliehenen Betrag zuzüglich Zinsen zurückzuzahlen. Was jedoch gibt man jenem zurück, der einem „das Dasein geschenkt hat“? Dieser Frage geht Aristoteles in seiner Nikomachischen Ethik nach, da der antike Philosoph das Verhältnis zwischen Eltern und ihren Kindern analog zu jenem von Gläubigern und Schuldnern sieht. Sei es die Erziehung, die Unterhaltskosten oder die Geduld mit dem Sprössling in den ermüdendsten Zeiten pubertärer Rebellion: Als Kind steht man tief in der Schuld gegenüber seinen elterlichen Gläubigern und, so Aristoteles, „wer schuldet, muss bezahlen“. Doch in welcher Währung muss die Rechnung beglichen werden und wann ist sie getilgt? Die Unterhaltskosten der betagten Ahnen zu übernehmen, ist schon mal ein Anfang, „da man hierin ihr Schuldner ist“. Doch mit Geld allein ist es nicht getan. Angesichts der „größten Wohltaten“ – die Schenkung des Daseins und die Erziehung – gebührt den Eltern jene Währung, die sonst vor allem den Göttern zukommt: Ehre. Das Verhältnis der Kinder zu ihren Eltern gleicht dem „der Menschen zu den Göttern“ und damit ist auch die Frage beantwortet, wann sie ihre Schuld abschließend beglichen haben: „Mit allem, was er tut“, könne der Nachwuchs, „die empfangenen Wohltaten nicht nach Würdigkeit vergelten und so bleibt er immer in der Schuld.“ Kinder schulden ihren Eltern also mehr, als sie ihnen jemals werden zurückzahlen können.
„Die Anerkennung ihrer Verdienste“
John Locke (1632-1704)
Der „bloße Akt der Zeugung“ gebietet dem Nachwuchs weder Ehre noch Dankbarkeit, Wohltaten wie die Erziehung zu einem freien Menschen dagegen schon. Das schreibt der englische Philosoph John Locke in seinen Zwei Abhandlungen über die Regierung (1689). Für den liberalen Denker ist klar: Jeder Mensch ist frei und gleich, aber Kinder seien nicht „in“, sondern „zur“ Gleichheit geboren. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Sprössling die Befähigung zur freien Selbstbeherrschung erlangt hat, muss er sich den Eltern unterordnen. Doch die „Fesseln der Unterordnung sind wie die Windeln“, in die das Kind gewickelt wurde, „Alter und Vernunft lockern sie, bis sie vollständig abfallen und einen Menschen hinterlassen, der frei über sich verfügt.“ Von nun an schuldet das Kind den Eltern keinerlei Gehorsam mehr. Das heißt jedoch nicht, dass es seinen Eltern gegenüber gar nicht mehr in der Verantwortung steht, denn „Freiheit entbindet nicht von der Ehre, die das Kind nach dem Gesetz Gottes und der Natur seinen Eltern schuldet“. Es obliegt den Kindern, die Eltern aus Dankbarkeit und Respekt für ihre Zuwendung zu unterstützen und nach Kräften zu ihrer Glückseligkeit beizutragen. Mit absoluter Hörigkeit hat das aber nichts zu tun, denn, so Locke, „Ehre, Respekt, Dankbarkeit und Unterstützung zu schulden, ist eine Sache, unbedingten Gehorsam und Unterordnung zu verlangen, eine andere.“
„Im engeren Sinne: nichts“
Joel Feinberg (1926-2004)
Der US-amerikanische Philosoph fragt sich, ob wir die Schuldner unserer Eltern sind, nur weil wir ihnen etwas schulden. In dem Aufsatz Duties, Rights and Claims (1966) erläutert Feinberg, dass die Bringschuld gegenüber einem Gläubiger wenig mit der Pflicht zu tun hat, sich einem Wohltäter erkenntlich zu zeigen. Man spricht zwar oft davon, dass man jemandem „Dankbarkeit schulde“, doch tatsächlich haben „meine Gefühle der Dankbarkeit keine nennenswerte Ähnlichkeit zu dem Gefühl, das ich gegenüber einem Kaufmann empfinde, der mir bestellte Waren liefert, bevor ich sie bezahlt habe.“ Die Schuld des Kindes gegenüber seinen Eltern hat daher auch nichts mit einer „Zahlung“ zu tun, denn Dankbarkeit ist keine Währung. Statt von Schuld sollten wir laut Feinberg lieber von einer „Pflicht der Erwiderung“ sprechen, zu der wir eine natürliche Neigung verspüren: Als wir der elterlichen Hilfe und Unterstützung bedurften, oblag es uns nur, unserer Dankbarkeit Ausdruck zu verleihen. Sofern sich das Blatt wendet und ich in der Position bin, zu helfen, dann wiederum haben die Eltern „ein Recht auf meine Hilfe“. Damit verbunden ist allerdings auch ihre Berechtigung, mir zu verübeln, wenn ich darin scheitere. Im engeren Sinne schuldet das Kind seinen Eltern also gar nichts, denn das Eltern-Kind-Verhältnis kennt keine offenen Rechnungen. Trotzdem bleibt es unsere Pflicht, dass wir uns dankbar und erkenntlich zeigen. •
Weitere Artikel
"Ich schulde euch gar nichts!"
Kinder schulden ihren Eltern Dankbarkeit, Fürsorge im Alter, ein gelungenes Leben? Weit gefehlt, meint die Philosophin Barbara Bleisch. Plädoyer für eine längst überfällige Befreiung.
Kinder haften für ihre Eltern
Verschwörungsdenken wird immer öfter zur familiären Belastungsprobe. Und dabei sind es zunehmend Kinder und Jugendliche, die ihre Eltern vor dem erkenntnistheoretischen Abgleiten bewahren wollen. Der Philosoph Jan Skudlarek über die Umkehr des Verantwortungsverhältnisses und über Wege aus der Höhle der „alternativen Fakten“.

Mit Kindern über Krieg sprechen?
Kinderpsychologen geben Eltern Rat, wie sie ihrem Nachwuchs den Krieg erklären können. Doch warum sollten Eltern die Antwort kennen? Ein Plädoyer für das Philosophieren mit Kindern – nicht nur in Krisenzeiten.

Die womöglich Letzte ihrer Art
Die Lockerung der Schuldenbremse ist entschieden, der Weg für ein Sondervermögen von 500 Milliarden für Investitionen in Klimaschutz und Infrastruktur ist frei. Der Druck auf die nächste Bundesregierung ist hoch, diese Chance zu nutzen, meint Oliver Weber.

Gefangen im griechischen Dilemma: Nichts geht mehr?
Angesichts der Schuldenkrise schwanken Athen und Europa zwischen zwei Optionen: Kooperation oder eigenmächtige Nutzenmaximierung (Defektion). Diese Alternative steht im Zentrum der Spieltheorie, einer Spezialität des griechischen Finanzministers Yanis Varoufakis. Er hat sich zu einem Gespräch mit dem Philosophen Jon Elster bereit erklärt, dessen Werk er seit langem kennt und schätzt. Gemeinsam wägen sie das Gewicht der Emotionen und der Geschichte ab, auch jenseits der ökonomischen Vernunft
Permanentes Misstrauensvotum
Nach langem Streit ist nun klar: Die Schuldenbremse soll auch 2024 eingehalten werden. Doch liegt in diesem Instrument ganz grundsätzlich eine hochproblematische Beschneidung demokratischer Freiheit.

Die Revolution geht weiter
Seit der dritte Stand 1789 die Bühne betreten hat, ist alle Geschichte die Geschichte von Verfeinerungskämpfen der Französischen Revolution. Sie werden darum geführt, welche Form die freigesetzten demokratischen Energien bekommen. Drei Konflikte stehen dabei im Mittelpunkt.
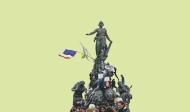
Alexis Lavis: „Der Geist der Fürsorge steht der Mentalität der Kontrolle gegenüber“
Die baldige Verfügbarkeit von Covid-19-Impfstoffen wirft moralische Fragen auf: Wer kommt zuerst dran? Bis wohin reicht die körperliche Selbstbestimmung? Ist es auch legitim, sich nicht impfen zu lassen? In unserer Reihe fragen wir Philosophinnen und Philosophen nach ihrer Position. In Folge 5 erklärt der in China lehrende Philosoph Alexis Lavis einen zentralen Unterschied zwischen Europa und Asien.
