Wer hat Angst vor der Spaltung?
Kaum eine Analyse der gegenwärtigen politischen Lage kommt ohne die Feststellung aus, dass die fragliche Gesellschaft gespalten oder polarisiert ist. Als Heilmittel werden Einheit und Zusammenhalt beschworen. Ein fataler Denkfehler.
Ob es um Lateinamerika oder um Israel geht, um die USA oder um Europa, wir hören immer wieder, dass die gefährlichste Tendenz unserer Zeit die zunehmende Spaltung des Gemeinwesens oder das Auseinanderdriften verschiedener Bevölkerungsgruppen ist. Im gleichen Atemzug wird dann generell auch das Gegengift beschworen: Zusammenhalt, gemeinsame Werte, Einheit. So auch in Frank-Walter Steinmeiers viel beachteter Rede zur Lage der Nation im Oktober. Mehrmals wiederholte er die Aufforderung, „alles zu stärken, was uns verbindet.‟
Die meisten Menschen, die das Weltgeschehen aufmerksam verfolgen, werden diese Sorge wohl teilen oder können zumindest den Wunsch nach einem friedlicheren Zusammenleben nachvollziehen – die apokalyptischen Befürworter eines Umsturzes am rechten Rand einmal ausgenommen. Aber welches Bild der Gesellschaft und des Politischen ist in diesen Diagnosen am Werk? Scheinbar eines, das fundamental entgegengesetzte Ansichten sowie offen ausgetragene Konflikte innerhalb der Gesellschaft als unvereinbar mit Demokratie versteht; das Division als beklagenswert und Konsens als erstrebenswert betrachtet. Vor allem setzt es ein Gemeinwesen voraus, das in sich geschlossen ist und sich nach außen hin abgrenzt. Grenzziehungen zwischen verschiedenen Gruppen innerhalb der gegebenen gesellschaftlichen Einheit – in der Regel geht es um die Nation – stellen somit eine Gefahr für diese Einheit dar. Oft unausgesprochen schwingt hierbei die Auffassung mit, dass eine bröckelnde Einheit die klare Kante nach außen unmöglich macht, diese wiederum gilt als überlebensnotwendig. Steinmeier hat es in seiner Rede ausgesprochen: Für den „Widerstandsgeist und [die] Widerstandskraft‟, die in der jetzigen Krise vonnöten wären, „gehört zuallererst [sic] eine starke und gut ausgestattete Bundeswehr‟.
Philosophie Magazin +

Testen Sie Philosophie Magazin +
mit einem Digitalabo 4 Wochen kostenlos
oder geben Sie Ihre Abonummer ein
- Zugriff auf alle PhiloMagazin+ Inhalte
- Jederzeit kündbar
- Im Printabo inklusive
Sie sind bereits Abonnent/in?
Hier anmelden
Sie sind registriert und wollen uns testen?
Probeabo
Weitere Artikel
Im Konfliktkessel der Gesellschaft
Spaltungsdiagnosen haben Hochkonjunktur. Wie polarisiert aber ist die deutsche Gesellschaft tatsächlich? Eine Analyse.

Mentoren – Engel auf Erden?
Wir haben es mit einem Fachkräftemangel in der Zwischenmenschlichkeit zu tun. Zu dieser Feststellung kommt unsere Autorin Birthe Mühlhoff und erläutert, warum wir zu besseren Mentoren werden, wenn wir uns an Engeln orientieren. Eine Anleitung in sieben Schritten.

Die neue Ausgabe: Können wir noch zusammen sein?
Beziehungen haben es heute schwer. Paare driften auseinander, entfremden sich. Politische Fragen spalten Familien und Freundeskreise. Wie lassen sich Fliehkräfte in Zusammenhalt verwandeln? Wie Einheit stiften, ohne Differenz zu unterdrücken?
Hier geht's zur umfangreichen Heftvorschau!
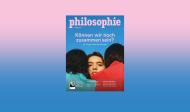
Sie ist wieder da. Die Frage nach der Identität.
In der gesamten westlichen Welt kehren Identitätsfragen ins Zentrum des politischen Diskurses zurück. Donald Trump stilisierte sich erfolgreich als Anwalt des „weißen Mannes“. Marine Le Pen tritt in Frankreich mit dem Versprechen an, die Nation vor dem Verlust ihrer Werte und Eigenheiten zu bewahren. Auch in Deutschland wird das Wahljahr 2017 von kulturellen Verlustängsten dominiert werden. Das Projekt der Europäischen Union droht derweil zu scheitern. Terrorangst schürt Fremdenfeindlichkeit Wie lässt sich diesen Entwicklungen gerade aus deutscher Sicht begegnen? Mit einem noch entschiedeneren Eintreten für einen von allen nationalen Spuren gereinigten Verfassungspatriotismus? Oder im Gegenteil mit neuen leitkulturellen Entwürfen und Erzählungen? Bei all dem bleibt festzuhalten: Identitätspolitik war in den vergangenen Jahrzehnten eine klare Domäne linker Politik (u. a. Minderheitenrechte, Genderanliegen). Sind bestimmte Kollektive schützenswerter als andere? Was tun, damit unsere offene Gesellschaft nicht von Identitätsfragen gespalten wird?
Im Reich der Geschwindigkeit
Kaum ein anderes Land wandelt sich derzeit so radikal wie China. Während in den hypermodernen Städten ein einzigartiger Leistungs- und Konkurrenzdruck herrscht, scheint in vielen entvölkerten Dörfern die Zeit wie stehen geblieben. Hartmut Rosa bereiste zwei Wochen das Reich der Mitte und zeichnet das Porträt einer gespaltenen Gesellschaft, die alles auf Aufstieg setzt. Doch zu welchem Preis?

Welche Idee der europäischen Einheit?
Der Ukrainekrieg hat die Einheit Europas durch eine Form von „negativer Solidarität“ gestärkt. Wichtig wäre jetzt allerdings, eine positive europäische Idee zu formulieren, die auf Frieden und Zusammenarbeit abzielt, meint Felicitas Holzer.

Kunst als Vollendung der Philosophie – Schelling zum 250. Geburtstag
Mit dem Deutschen Idealismus rückt das erkennende Subjekt in den Mittelpunkt. Nicht so für Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, der Mensch und Welt, Ich und Natur als Einheit begreift. Zum 250. Geburtstag erinnert Christoph Kann an den Philosophen und erklärt, warum diese Einheit in der Kunst vollends erfahrbar wird.

Weder Heilserwartung noch Apokalypse: Warum wir eine andere Zukunft nötig haben
Die Krise ist längst das neue Normal, die gegenwärtigen Zukunftsszenarien sehen düster aus. Wie „die Zukunft“ als gemeinsamer Sehnsuchtsort entstand, warum sie mal erhofft und mal gefürchtet worden ist, und weshalb Krisen sowohl zu einem kollektiven Aufbruch als auch zu Resignation führen können. Eine Analyse.
