Dark Pattern und Nudges - werden wir manipuliert?
Im digitalen wie im analogen Leben: Sogenannte „Nudges“ und „Dark Pattern“ sind überall. Was sollen wir halten von diesen „Anstupsern“? Und wie können wir zwischen Beeinflussung und Manipulation unterscheiden?
Sie sind gerade dabei eine neue Software herunterzuladen und während der Installation bietet Ihnen der Anbieter an, einen Newsletter zu abonnieren. Das wollen Sie jedoch nicht, also entfernen Sie spontan das kleine Häkchen aus dem vermeintlichen Zustimmungskästchen. Nur haben Sie nicht aufmerksam genug gelesen: Der kleine Hinweis lautete in Wirklichkeit, dass Sie das Kästchen ankreuzen müssen, wenn Sie den Newsletter nicht erhalten wollen. Und schon haben Sie ein Abonnement mehr ...
Kommerzielle Täuschungen
Diese Umkehrung ist eine Falle, die einen Namen hat: Dark Pattern, ein Begriff, der mit „manipulierter Oberfläche“ oder „Benutzerfalle“ übersetzt werden kann. Im Bereich des digitalen Designs ist ein Dark Pattern ein in die Benutzeroberfläche einer Website eingebauter Mechanismus, der versucht, den Nutzer zu täuschen: eine Werbung, die dem Aussehen der Website, die man bereits kennt, zum Verwechseln ähnlich sieht und deswegen einen Klick nach sich zieht, oder eine Website, die die Möglichkeit verschleiert, sein Konto zu löschen oder sich abzumelden, sind nur einige Beispiele. Bei Videospielen für das Handy bieten die Entwickler das Spiel oft kostenlos an, machen aber ihren Profit, indem ein Teil des Inhalts doch gebührenpflichtig ist.
Es kommt vor, dass derselbe grüne Knopf, der dem Spieler stundenlang den Erfolg eines Levels und den Übergang zum nächsten signalisiert, ab einem bestimmten Zeitpunkt (mit derselben Farbe und demselben Aussehen) zu einem Knopf für den käuflichen Erwerb des nächsten Levels wird. So konditioniert durch wiederholtes Drücken der Taste „Zum nächsten Level gehen“ in Verbindung mit einer positiven Stimulation, klickt der unaufmerksame Spieler dann einfach weiter – und gibt unwissentlich sein Einverständnis für den Kauf des nächsten Levels. Diese skrupellosen Mechanismen werden vielfach kritisiert, sind aber trotz der Versuche, sie zu regulieren, omnipräsent.
Nicht mehr Herr der eigenen Maus
Jeder kennt das Einwilligungsfenster zur Verwendung persönlicher Daten: Alle Websites, die mit unseren Daten Geschäfte betreiben wollen, sind gezwungen, uns um unsere Zustimmung zu bitten, bevor sie sich diese aneignen. Nun ist es meist deutlich einfacher sein Einverständnis zu erteilen, als es zu verweigern, da sich die Verweigerung hinter Worten wie „Weitere Optionen “ verbirgt, deren Unübersichtlichkeit den eiligen Internetnutzer entmutigen kann. Auch dies ist ein Dark Pattern, das übrigens in Kalifornien seit 2021 verboten ist. Auch die Gesetzgebung der Europäischen Union arbeitet seit einigen Jahren an einem Gesetzesentwurf zur Regulierung der Dark Patterns. Am 05.Juli 2022 wurde ein Gesetz über digitale Dienste und über digitale Märkte beschlossen, das eine transparentere und verständlichere Nutzung digitaler Dienste im Sinne des Verbrauchers vorsieht. Die tatsächliche Umsetzung wird jedoch wahrscheinlich erst im Laufe des Jahres 2024 stattfinden.
Genau das versucht das Dark Pattern zu umgehen: Indem es die eigentlichen Voraussetzungen für eine Entscheidungsfindung verschleiert, beeinträchtigt es die Fähigkeit, eine freie Wahl zu treffen. Das Ziel der Dark Patterns ist es, den Nutzer dazu zu verleiten, eine Entscheidung zu erzwingen, ohne dabei jedoch auf direkten Zwang zurückzugreifen. Indem es unsere Denkmuster und Automatismen ausnutzt, wie z. B. die Annahme, dass „ein Häkchen zu setzen, bedeutet, in etwas einzuwilligen“, wirken Dark Patterns wie Täuschungsmanöver und Fallen, die unseren freien Willen untergraben und in der Regel wirtschaftlichen Interessen dienen. Unter dem Einfluss von Dark Patterns sind unsere Entscheidungen nicht mehr unsere eigenen. Wir sind nicht mehr autonom in dem Sinne, dass wir die Gesetze, die unser Handeln bestimmen, nicht mehr selbst durch unsere eigene Vernunft festlegen.
„Nudge“, eine altbewährte Praxis
Doch diese Praktiken, die allgemein als manipulativ kritisiert werden, sind nicht die einzigen Mechanismen des digitalen Zeitalters, die dasselbe Ziel verfolgen. Der Begriff Nudge (eine mögliche Übersetzung wären die Wörter „Schubser“ oder „Anstoß“), wurde von dem Juristen Cass Sunstein und dem Wirtschaftswissenschaftler Richard Thaler theoretisch begründet und ist ebenfalls eine Technik, mit der man jemanden dazu veranlassen will, eine Entscheidung zu treffen, die er selbst nicht getroffen hätte, ohne dabei jedoch auf Zwang zurückzugreifen. Die Lösung des Nudge besteht darin, in die „Architektur der Entscheidung“ der Person einzugreifen.
Ein einfaches Beispiel: Wenn ich in ein Geschäft komme, beeinflusst die Anordnung der Produkte an der Ladentheke mein Interesse und meine Wünsche. Wenn es um die Gestaltung einer Ladentheke geht, erscheint dies natürlich harmlos. Geht man in einer Kantine ähnlich vor, dann kann das sogar positive Auswirkungen haben: Indem man die gesündesten Lebensmittel auf Augenhöhe anbietet, regt man dazu an, bewusster zu essen, anstatt sich auf fett- und zuckerhaltige Produkte zu stürzen. Um die Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel in Schweden zu mehr Bewegung zu ermutigen, haben die Behörden die Treppen mit Klaviernoten bemalt. So haben sie die Nutzer dazu gebracht, auf die Noten zu hüpfen, anstatt den bequemen Fahrstuhl zu nehmen. Ein letztes Beispiel, das den Männern wohlbekannt ist und dem Kollektiv zugutekommt, ist das Bild einer Fliege in ein Pissoir zu kleben, die dann von den Männern anvisiert wird. So geht weniger daneben und die Toiletten bleiben sauberer.
Der Nudge versucht also unsere Bedürfnisse von Grund auf zu verändern, indem er uns beispielsweise dazu bringt, gesünder zu essen oder weniger Dreck zu machen. Das Dark Pattern verwendet die Nudge-Technik mit weniger hehren Zielen, indem es uns dazu bringt, uns in Einzelfällen zu täuschen und somit gegen unseren Willen zu handeln und beispielsweise einen Newsletter zu bestellen, den wir nicht wollten. Beide Fälle gehören jedoch zu einem Geflecht von unsichtbaren Methoden, die darauf abzielen, unseren freien Willen zu beeinflussen. Sollte man jetzt daraus die Schlussfolgerung ziehen, dass alle diese Strategien abzulehnen sind? Die Frage ist doch, wann aus einem sanften Anreiz eine unheilvolle Manipulation wird.
Zwischen Beeinflussung und Manipulation unterscheiden
Der amerikanische Philosoph Robert Noggle, Professor an der University of Michigan, hat sich mit jener Differenzierung befasst. In einem Artikel aus dem Jahr 1996 (Manipulative Actions: A Conceptual and Moral Analysis) schreibt er: „Es gibt immer bestimmte Normen oder Ideale, die unsere Überzeugungen, Wünsche und Gefühle steuern. Manipulative Handlungen sind Versuche, eine Person dazu zu bringen, ihre Überzeugungen, Wünsche oder Emotionen gegen ihre Ideale zu richten.“ Wenn wir unsere Entscheidungen nach unserem eigenen Gesetz treffen, ohne dabei manipuliert zu werden, zielen unsere Handlungen auf ein Ideal ab, das wirklich unser eigenes ist (unabhängig davon, ob dieses Ideal gut oder schlecht ist). Manipulation bedeutet jedoch, dass unsere Entscheidungen so korrumpiert werden, dass sie nicht mehr unserem eigenen Ideal, sondern dem des Manipulators entsprechen. Indem der Manipulator unsere Überzeugungen, Wünsche oder Gefühle beeinflusst, lässt er uns für seine Interessen arbeiten und führt uns von unseren eigenen fort. Wir werden dabei in dem Glauben gelassen, unserem Ideal zu folgen, obwohl wir eigentlich nur nach seinem handeln. Wenn ich dagegen jemanden bewundere und ihm folge, weil wir ein Ideal teilen, werde ich zwar beeinflusst – aber nicht manipuliert, da mein Ideal mit seinem übereinstimmt.
Wenden wir diese Unterscheidung auf Dark Patterns und Nudges an. Der Rohkost-Nudge auf Augenhöhe ist ein Einfluss, der nicht manipulativ ist, wenn der Nutzer kein Ideal hat, das dem einer ausgewogenen Ernährung widerspricht. Im gegenteiligen Fall wäre es eine Manipulation. Bei einem Dark Pattern, dass mir noch mehr E-Mails einbrockt, die ich gar nicht will, künftig aber bekomme, weil ich nicht achtsam genug war, handelt es sich allerdings um Manipulation. Das entscheidende Kriterium, um schädliche digitale Mechanismen zu erkennen, wäre also, sich immer wieder die Frage zu stellen: Veranlassen sie uns, gegen unsere eigenen Ideale zu handeln? •
Weitere Artikel
Gestupst in ein besseres Leben?
Sogenannte „Nudges“ sind überall: auf Zigarettenschachteln, in Selbstbedienungsläden und Krankenhäusern. Was sollen wir halten von diesen „Anstupsern“, die uns dazu bewegen wollen, Gutes zu tun?

Der Mythos unterbewusster Manipulation
Eine US-Biermarke versuchte jüngst, Menschen im Schlaf zu beeinflussen, wogegen Wissenschaftler nun mit einem offenen Brief protestieren. Doch verrät der Fall mehr über die Sehnsucht von uns Konsumenten als über die Macht der Manipulation.

Nudging
Der vom Ökonomen Richard Thaler und Rechtswissenschaftler Cass Sunstein geprägte Begriff „Nudge“ (engl. Stups) meint die Methode, Menschen ohne Vorschriften oder Verbote, sondern allein durch die strategische Modellierung von Entscheidungssituationen zu einem bestimmten Verhalten zu animieren.
Die neue Ausgabe: Muss ich da mitmachen?
Ob im Netz oder in der analogen Welt: Menschen passen sich leicht an Gruppen an. Folgen Trends. Machen mit. Oft mit fatalen Folgen. Wie also werde ich innerlich freier? Was hilft mir, mich abzugrenzen? Nein zu sagen? Meinen eigenen Weg zu finden?
Hier geht's zur umfangreichen Heftvorschau!
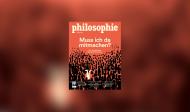
Gaslighting: Die Verdunkelung der Seele
Gaslighting gehört zu den weitverbreitetsten und gefährlichsten Formen der zwischenmenschlichen Manipulation. Um zu verstehen, wie es funktioniert und wie man sich dagegen wehren kann, hilft ein Blick in das Werk Michel Foucaults.

Die Zeit der Megafeuer
Überall auf der Welt häufen sich sogenannte Megafeuer. Ergebnis der globalen Erwärmung oder des Verschwindens von „Feuertechniken“ in westlichen Gesellschaften? Ein Gespräch mit der Philosophin Joëlle Zask.

Lässt sich Liebe regeln?
Immer mehr Paare halten ihre Beziehungsaufgaben in sogenannten „love contracts“ fest. Aber kann zwischen Vertragspartnern echte Romantik entstehen?

Warum wir Verschwörungstheorien manchmal ernst nehmen sollten
Der Angriff auf Trump führte schnell zu wilden Spekulationen. Um mit diesen angemessen umzugehen, sollten wir zwischen Verschwörungstheorie und -mythos unterscheiden.
