Der Staat als Partisan
Obwohl Russland kaum Macht besitzt, kann es die Welt in Angst versetzen – und am Ende gar zum Sehnsuchtsort werden, sobald der Klimawandel zuschlägt.
Das Eigenartigste am Ukrainekrieg ist vielleicht, dass er von einem Land geführt wird, das dazu eigentlich nicht in der Lage sein sollte. Russland ist ein Zwerg – es hat weniger Einwohner als Bangladesch, eine Wirtschaftskraft, die mit der spanischen vergleichbar ist, ist weder Finanzmacht noch Technologiezentrum oder Traumregion, besitzt demnach kaum Soft Power. Ein Gebilde also, das geopolitisch keine Rolle spielen dürfte, rückt ins Zentrum des Weltordnungskampfes und könnte einen Flächenbrand oder das Ende der Welt auslösen.
Früher musste man eine große Macht sein, sich anstrengen und etwas können, um geopolitisch mitmischen zu dürfen. Das galt auch für die Sowjetunion, die nach dem Zweiten Weltkrieg mehr Einwohner als die USA, beinahe halb so viele wie China hatte, technologisch mithalten konnte und die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt besaß. Heute leben in den USA doppelt, in EU-Europa dreimal, in China zehnmal so viele Menschen, die Russland wirtschaftlich und technologisch überrundet haben. Eine Idee, die weltweit von einem besseren Leben träumen lässt – etwa den Kommunismus – besitzt Russland auch nicht. Es hat nur sich selbst, sein Gas und seine Raketen.
Eine Landschaft mit Raketen
Dennoch reicht das, um die Weltordnung durcheinanderzuwirbeln. Niemand traut sich, den Rabauken zurechtzuweisen, weil er neben Atomwaffen eine gigantische Kriegsmaschine besitzt, die beinahe von allein läuft. Gefüttert wird sie mit Einnahmen aus dem Öl- und Gasexport. Natur und Technik haben sich zu einem Mechanismus verschaltet, der den menschlichen Eingriff kaum noch braucht. Russland, könnte man in Abwandlung eines Helmut-Schmidt-Bonmots sagen, ist eine Landschaft mit Raketen, ein Kommunikationsfeld zweier Naturen (der natürlichen und der (kriegs-)technologischen), aus dem der Mensch beinahe verschwunden ist.
Das war im 20. Jahrhundert noch anders, als möglichst viele Menschen möglichst intensiv für eine Sache eingespannt werden mussten, um Macht zu erlangen. Höhepunkt war der Totalitarismus, der die Massen dirigierte, aber auch der Liberalismus beherrschte entsprechende Techniken. Moderne Geopolitik ist die Geschichte wachsender Massenmobilisierung, seit der Merkantilismus auf eine Verbindung von Demografie, Prosperität und Wehrhaftigkeit setzte, um die Position des Landes im Weltsystem zu optimieren.
Natürlich hat es auch kleine Länder gegeben, die eine Rolle gespielt haben – Venedig im 15., Portugal im 15. und 16. oder die Niederlande im 17. Jahrhundert zum Beispiel. Jedoch waren sie weder militärisch in der Lage noch daran interessiert, eine Ordnung zu sprengen, von der sie profitierten. Ihre Macht beruhte auf kommerzieller oder technologischer Finesse – an irgendeiner Stelle waren sie moderner als die anderen. Das trifft auf Putins Russland nicht zu. Es ist ein alter, wilder Mann, in allen Belangen unterlegen und trotzdem ein Sicherheitsrisiko, ein ungenießbarer Brocken, den die Weltgeschichte eigentlich schon geschluckt hatte, und der ihr nun quälend im Magen liegt.
Der Staat als Partisan
Philosophie Magazin +

Testen Sie Philosophie Magazin +
mit einem Digitalabo 4 Wochen kostenlos
oder geben Sie Ihre Abonummer ein
- Zugriff auf alle PhiloMagazin+ Inhalte
- Jederzeit kündbar
- Im Printabo inklusive
Sie sind bereits Abonnent/in?
Hier anmelden
Sie sind registriert und wollen uns testen?
Probeabo
Weitere Artikel
Was weiß mein Körper?
Die Frage irritiert. Was soll mein Körper schon wissen? Ist das Problem denn nicht gerade, dass er nichts weiß? Weder Vernunft noch Weisheit besitzt? Warum sonst gibt es Gesundheitsratgeber, Rückenschulen, Schmerztabletten, viel zu hohe Cholesterinwerte. Und wieso gibt es Fitness-Tracker, diese kleinen schwarzen Armbänder, die ihrem Träger haargenau anzeigen, wie viele Meter heute noch gelaufen, wie viele Kalorien noch verbrannt werden müssen oder wie viel Schlaf der Körper braucht. All das weiß dieser nämlich nicht von selbst – ja, er hat es bei Lichte betrachtet noch nie gewusst. Mag ja sein, dass man im 16. Jahrhundert von ganz allein ins Bett gegangen ist. Aber doch wohl nicht, weil der Körper damals noch wissend, sondern weil er von ruinöser Arbeit todmüde und es schlicht stockdunkel war, sobald die Sonne unterging. Wer also wollte bestreiten, dass der Körper selbst über kein Wissen verfügt und auch nie verfügt hat? Und es also vielmehr darum geht, möglichst viel Wissen über ihn zu sammeln, um ihn möglichst lang fit zu halten.
Thomas Fuchs: „Ein angstfreies Leben wäre ein gleichgültiges Leben“
Die Angst ist so alt wie die Menschheit. Bis heute ist kaum ein Gefühl so mächtig und verbreitet. Woran liegt das? Ein Gespräch mit dem Psychiater und Philosophen Thomas Fuchs über die leibliche Erfahrung der Angst, ihre Wurzeln und „Verkleidungen“, und wie man sich die Angst zum Freund macht.

Die sichtbare Hand des Marktes
Es war keine utopische Spukgeschichte: Als Karl Marx und Friedrich Engels in ihrem 1848 erschienenen Manifest jenes „Gespenst des Kommunismus“ beschworen, das Kapitalisten in Enteignungsangst versetzen sollte, war das für sie vielmehr eine realistische Zukunftsprognose. Denn Marx und Engels legten großen Wert darauf, dass es sich im Kontrast zu ihren frühsozialistischen Vorläufern hier nicht um politische Fantasterei, sondern eine geschichtsphilosophisch gut abgesicherte Diagnose handle: Der Weltgeist sieht rot.

Paul-Philipp Hanske: „In der Ekstase blitzt die Möglichkeit einer belebten Welt auf“
Seit jeher nutzen wir Pflanzen, um uns in andere Bewusstseinszustände zu versetzen. Der Soziologe Paul-Philipp Hanske, selbst ein Freund der Ekstase, erläutert im Interview, warum die Geschichte unserer Spezies eng mit psychoaktiven Pflanzen verwoben ist.

Meine Toleranzgrenze
Die Zuschreibung des Bösen liegt nahe, sobald ein Gegenüber sich an Werten orientiert, die man selbst für problematisch oder gar gefährlich hält. Fünf Menschen erzählen.
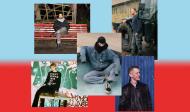
Die neue Ausgabe: Was machen wir mit unseren Ängsten?
Angst lähmt. Wer sie empfindet, will sie schnell wieder loswerden. Doch was, wenn in der Angst eine Chance läge? Wie kann es gelingen, diesem negativen Gefühl ein produktives Potenzial abzuringen? Lässt sich Angst gar als Möglichkeit für eine freiere Existenz begreifen?
Hier geht's zur umfangreichen Heftvorschau!

Stephen Greenblatt: „Sobald man Teil der Lüge wird, ist man nicht ihr Opfer"
Um heutige Autokratien zu verstehen, muss man den bekanntesten Schriftsteller der Welt lesen: William Shakespeare. Ein Gespräch mit dem Literaturwissenschaftler Stephen Greenblatt über die Funktion von Fiktionen und die Geburt der Macht aus dem Drama
Kann das weg?
Es gibt Begriffe, bei denen weiß man, sobald sie am Horizont auftauchen: Sie bringen Unheil mit sich. „Systemrelevant“ ist ein solcher Begriff, meint Thea Dorn.
Kommentare
Erstaunlich, wie Moritz Rudolph - nach Art von Obama - Russland kurzerhand als geopolitisch unbedeutend verkennt.
Ich erspare mir die Aufzählung der geopolitisch bedeutsamen Daten und Dimensionen, die über den geopolitischen Status Russlands Auskunft geben.
Soft Power wird zwar weiter wichtig bleiben. Der Krieg in der Ukraine, das sollten die Kriege nach 1991 doch vor Augen, könnten aber die Erkenntnis befördern, dass militärische Fähigkeiten nicht etwa überflüssig geworden sind, dass atomare Rüstung wieder an Bedeutung gewinnt. Atomare Abschreckung und zugleich konventionelle militärische Fähigkeiten gewinnen an erschreckender Bedeutung.
Die These des Autors, Russland als Sehnsuchtsort des Anthropozäns, scheint doch angesichts aktueller Kriegseindrücke geradezu degoutant.
Will da jemand am aktuellen Framing drehen?