Florian Schroeder: „Wir müssen den Täter in uns wahrnehmen“
Die Fronten zwischen rechts und links scheinen sich immer noch weiter zu verhärten. In seinem neuen Buch Schluss mit der Meinungsfreiheit! schlägt der Kabarettist Florian Schroeder die Lektüre Hegels als Gegenmittel zum Lagerdenken vor und verrät, worin er heute die Aufgabe der Satire sieht.
Herr Schroeder, in ihrem jüngst erschienenen Buch Schluss mit der Meinungsfreiheit! vergleichen Sie die Frage „Können wir heute noch alles sagen?“, mit einer Colaflasche die man öffnet, nachdem man sie ausgiebig geschüttelt hat. Bedeutet das, dass wir alles sagen können und dürfen, weil nur so darauf losgesprudelt wird?
Ich bin der festen Überzeugung, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland nicht in Gefahr ist. Ganz im Gegenteil: Wir können heute freier reden als je zuvor. Man kann heute beispielsweise sagen, dass das Dritte Reich ein „Vogelschiss“ war und findet als Politiker weiter statt. Man kann Applaus aus bestimmten Kreisen ernten, wenn man das Holocaustmahnmal als ein „Denkmal der Schande“ bezeichnet. Oder Sie können in der taz in einer Kolumne schreiben, dass Polizisten auf die Müllhalde gehören. Rechtlich ist all das möglich. Was allerdings zugenommen hat, ist eine Enge hinsichtlich der moralischen Sanktionierung dessen, was gesagt wird.
Sie haben die Frage nach der Meinungsfreiheit letztes Jahr praktisch im Selbsttest erprobt, indem Sie im Juni auf einer „Querdenkerdemo“ in Stuttgart aufgetreten sind und sich selbst als Querdenker ausgegeben haben. Begleitet von entsprechenden Inhalten auf Ihrer Facebookseite. Welche Reaktion hat sie von den Anwesenden am meisten erstaunt?
Verwundert haben mich besonders zwei Dinge: Zum einen, dass schon in Stuttgart ca. ein Drittel des Publikums applaudiert hat und die Aktion gut fand. Man hat es hier also nicht nur mit Menschen zu tun, die für den Dialog verloren sind. Zum anderen hat mich die Qualität des Hasses doch erstaunt, die mir entgegenschlug. Mir war schon klar, dass das kommen würde und ich nicht auf ungeteilte Gegenliebe stoßen würde, dafür bin ich zu lange im Geschäft. Allerdings verlieren einige Menschen in solchen Situationen sämtliche Hemmungen und es gibt nichts mehr unter „Hängt ihn!“ und dergleichen. Wenn also nun ein Maskenverweigerer in Idar Oberstein zum Mörder wurde, so ist das leider wenig überraschend, da es sich in der digitalen Welt sprachlich lange andeutete.
Würden Sie denn nun mit etwas Abstand sagen, dass dieses Experiment der Meinungsfreiheit geglückt ist?
Das würde ich hoffen, denn mein Grundanliegen war, zu sehen, wie weit die Toleranz dieser Leute geht, die behaupten, die Meinungsfreiheit sei eingeschränkt, weil es eine Diktatur gebe. Zugleich erzählen sie genau die Dinge auf Demos, die in keiner Diktatur möglich wären. Wie man an den militanten zwei Dritteln des Stuttgarter Publikums sehen konnte, die mich ausgebuht haben, geht die Meinungsfreiheit bei ihren großen Verteidigern gar nicht besonders weit. Zudem war es spannend, mich auf vermintem Boden zu bewegen: Meine Sendung gucken Menschen, die mich mutmaßlich mögen und zu meinen Shows kommen Menschen, die vermutlich gut finden, was ich mache. In Stuttgart allerdings trat ich vor ein Publikum, das für mich vollkommen unberechenbar war. Ich habe mich dieser unwägbaren Situation mit offenem Visier gestellt, was sehr erkenntnisreich war.
Damit haben Sie eigentlich genau das Spiel mit Rollen vorweggenommen, für das Sie auch im Buch werben.
So könnte man es sehen. Ich halte es tatsächlich für problematisch, dass wir uns unserer verschiedenen Rollen heute zu wenig bewusst sind. Wir stellen das Identische, das vermeintlich Authentische und Private zu oft in den Mittelpunkt. Ich würde mir wünschen, dass ich durch den Auftritt zeigen konnte, dass man in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich auftreten und dadurch etwas Neues entstehen lassen kann. Die Intention dieses Experiments war es, die Dialektik der Meinungsfreiheit zu zeigen und ich würde behaupten, dass das geglückt ist.
Dialektisch im Sinne Hegels?
Karl Rosenkranz schreibt in seiner sehr lesenswerten Biographie Hegels Leben, dass Hegels große dialektische Leistung eigentlich darin bestand, sich „bis in die letzten Fasern des Gegners“ in dessen Denken hineinzuversetzen, dessen Positionen und Argumente in sich aufzunehmen um dann – und das ist der entscheidende Punkt – über sie hinauszugehen. Das ist es, was ich am dialektischen Denken für wesentlich halte. Keine Angst vor Ansteckung, sondern Immunisierung durch gezielte Infektion mit dem Anderen, dem Fremden, auch dem Abgründigen. Was im Gegensatz wenig mit Dialektik zu tun hat, ist dieser biedere Deutschunterrichts-Habitus: Wir haben eine These und eine Antithese und dann kommen wir zu einem lauwarmen Kompromiss in der Synthese. Ziel müsste es sein, zu etwas Höherem zu kommen, was beide Positionen zugleich überwindet und einbezieht. Hegel widersprechen würde ich allerdings bei seiner Verabsolutierung des Identischen, das immer auch etwas Totalitäres hat. Genau das ist meine Kritik an den extremen Lagern der rechtsidentitären Märtyrer und der linksidentitären Inquisitoren. Beide Lager beharren auf dem Identischen als Ziel und nicht als etwas, dem man sich annähern kann durch Überantwortung an ein Fremdes; das zu erreichen allerdings unmöglich ist. Denn der völlig mit sich identische Mensch wäre der tote Mensch. Ich lehne dies auch deshalb ab, weil das Streben nach Identität immer fundamentalistisch bleibt. Ihm liegt eine Reinheitsphantasie zugrunde, die ich für problematisch halte. Auf der einen Seite eine rassistisch – völkische und auf der anderen eine moralische Reinheit, in der nur gelten darf, was Opfer und damit schwach ist und sich nicht mit dem Bösen der Welt beschmutzt hat. Beides ist auf seine Weise gefährlich. Ich bin hier also eher auf der Linie Adornos, der gerade die Nichtidentität stark macht.
Ein anderer Befürworter von Rollen und damit dem Nichtidentischen wäre Michel Foucault. Können Sie auch dem Poststrukturalismus etwas abgewinnen?
Unbedingt. Ich habe erst kürzlich wieder das Interview mit Foucault gelesen, das er Le Monde 1980 unter dem Titel Der maskierte Philosoph gegeben hat. Der Twist an diesem Interview ist: Foucaults Name taucht nirgends auf. Alles, was gesagt wird, wird allein durch das Gesagte transportiert und der Name, der oft als erster Indikator dafür funktioniert, ob man dem Gesagten gewogen oder abgeneigt gegenübertritt, fehlt komplett. Ein solches Experiment scheint mir vor dem Hintergrund der Überbelichtung von Sprecherpositionen aufgrund von Identität durchaus reizvoll. Die Frage wäre nicht: Wer spricht und wie ist das einzusortieren, sondern: was wird gesagt und wie wird es begründet – Sprechen ohne Spot auf die Person. Wir hätten es hier also mit Roland Barthes Tod des Autors zu tun. Aber nicht als apokalyptische Grabrede, sondern als spielerisches Argument, als Ausprobieren von Gedanken ohne Absender. In Schluss mit der Meinungsfreiheit fordere ich dazu auf, ein zweites Social Media-Ich zu schaffen, das nur Accounts und Positionen folgt, die man eigentlich ablehnt. Sie werden sich selbst als Fremden kennenlernen.
Eine solche Interviewreihe würde die bereits angesprochen Unterscheidung in Freund und Feind herausfordern.
Das Einsortieren in Kategorien wie Freund und Feind, Gut und Böse, moralisch oder unmoralisch nimmt tatsächlich zu. Es findet eine verbale und moralische Aufrüstung statt, die, wenn ich pessimistisch bin, fast einer Art Vorkriegszeit ähnelt. Wenn Sie sich die Begriffe angucken, die Klaus Theweleit in seinen Männerphantasien beim soldatischen Mann der 1920er-Jahre findet, jenem präfaschistischen Männertypus, so lässt sich die Diagnose einer erstarrten Härte und Leblosigkeit seiner Sprache anwenden auf die Schützengräben auf Twitter und Facebook heute. Es werden Stellungskriege geführt und wir scheinen die Fähigkeit des Verzeihens zu verlernen. Immer weniger arbeiten wir mit dem lebendigen Prinzip von Versuch und Irrtum und immer öfter versuchen wir, Menschen zügig auszuschließen, weil sie hier oder da etwas Falsches gesagt haben.
Worin besteht in einer derart aufgeladenen Stimmung die Rolle der Satire?
Ich neige zu der Auffassung, dass Satire zumindest in Deutschland zu viel Selbstversicherung bietet. Und dabei schließe ich mich und meine Arbeit ausdrücklich ein. Mit dem Arabisten Thomas Bauer könnte man das Problem so beschreiben, dass sie gerade nicht die Ambiguitätstoleranz fördert, sondern zu klare Antworten gibt. Man predigt heute oft zu den Bekehrten und bestätigt das Publikum in seiner aktuellen Haltung, statt es herauszufordern oder gar produktiv zu verstören. Ich halte es mit Adorno, der als oberstes Gebot der Kunst ausgab „Chaos in die Ordnung zu bringen“. Kurz gesagt: Die Aufgabe der Satire müsste heute darin bestehen, dass der Künstler zum Täter wird. Er darf nicht die Haltung einnehmen, dass wir alle nur Opfer der Politik seien und die da oben „einfach machen“. Das halte ich für einen volkstümlichen und im Kern antidemokratischen Zugang. Der Versuch sollte sein: „Ich bin Täter und ihr seid es auch! Deshalb zeigen wir uns unsere dunklen Seiten und verlassen die eigene Comfortzone.“ Gerade in einer Zeit, die so viel Energie auf Opferbegutachtung verwendet, müssen wir den Täter in uns wahrnehmen: Sonst bleiben wir der neobarbarischen Dialektik von Opfer und Rache verschwistert.
Haben Sie aus diesem Grund auch Atila Hildmann so oft begleitet und ausführlich beschrieben?
Ich finde es wichtig, sich diesen Zerrspiegel anzugucken und zu sehen, dass Figuren wie Hildmann nicht nur die Idioten, Vereinsamte und Gescheiterte sind, sondern unsere Schatten. Die Anteile des Wahnsinns sind auch in uns. Niemand kann das völlig von sich weisen. Hildmann ist auch nur einer, der immer sicher war, dass er auf der richtigen Seite ist. Denn wenn man genauer hinschaut, ist die Wandlung vom sympathisch-smarten Vegan-Koch zum keifenden Rassisten Hildmann gar nicht so groß. Die Linie, die alles verbindet, ist sein Selbstverständnis als Guru: „Ich sehe mich als Picasso der Ernährung“ lautet beispielsweise ein Satz von ihm. „Ich habe mein Leben der Wahrheit verschrieben“ ein anderer. Die Sätze sind immer totalitär und vollkommen eindeutig.
Stichwort Eindeutigkeit: In welchen Momenten auf der Bühne haben Sie das Gefühl alles aus der Kunstform der Satire herauszuholen?
Im aktuellen Programm behaupte ich, dass ich mit Satire aufhöre und Bundeskanzler werden will. Anschließend stelle ich mein komplett linkes Programm vor: Bedingungsloses Grundeinkommen, Digitalisierung der Schulen, Verbot von Inlandsflügen. Auch das feiern die Leute. Zumindest bis ich es breche und zeige, dass daraus auch eine brutale Diktatur nach chinesischem Vorbild resultieren kann. Ich mag tatsächlich, wenn ich diesen Schwebezustand erzeugen kann und sich die Leute nicht mehr sicher sind, was der da vorne jetzt eigentlich will.
Provokation von Kabarett- oder Comedybühne herunter sind die eine Sache. Wie stehen Sie allerdings Forderungen wie der Chantal Mouffes gegenüber, die für einen linken Populismus wirbt?
Davon halte ich gar nichts. Das ist der billige Versuch, das, was man an der Gegenseite kritisiert, plötzlich für sich umzudeuten und als produktiv darzustellen. Das ist unlauter. Ich bin kein Freund des Populismus. Und zwar egal aus welcher Richtung. Gleichzeitig muss man so ehrlich sein und sich eingestehen, dass davor niemand gefeit ist. Sicherlich findet man auch in meiner Arbeit Sätze, die man populistisch auslegen kann. Auch wenn das Ziel ist, zu verdichten, ohne zu vereinfachen, erreicht man diese Maßgabe natürlich nie ganz. Ich würde eine Lanze für eine Streitkultur brechen, die nicht zwangsweise etwas mit Harmonie zu tun hat, sondern mit einer zivilisierten Art, miteinander umzugehen. In erster Linie würde das bedeuten, dass wir nicht mehr alles persönlich nehmen. Wir scheinen immer schlechter dazu in der Lage, Person und Thema zu trennen. Dabei kann man hervorragend leidenschaftlich mit jemandem über ein Thema streiten und sich dennoch bestens mit ihm verstehen. Weil wir aber die Trennung zwischen öffentlicher und privater Rolle immer mehr verschwimmen lassen, wird alles privat und man endet als notorisch Beleidigter.
Nun haben wir vorhin viel über Querdenker gesprochen, die teils militant gegen Personen vorgehen, die sie als Feind identifizieren. Welche Gefahr für den Diskurs sehen sie von „woken“ Personen, Unis und Unternehmen?
Bevor ich auf die Parallelen eingehe, müssen wir über Differenzen sprechen. Denn es gibt bisher keine linke und keine linksextreme Person, die in Synagogen und Moscheen reingefahren ist. Und es gibt auch keine linke, woke Person, die einen Politiker wie Walter Lübcke erschossen hat. Der Rechtsextremismus ist also die erste Gefahr, die die liberale Demokratie bekämpfen muss. Da sind die Zahlen eindeutig und das muss über allem stehen, um das Singuläre dieser Bedrohung nicht zu relativieren. Dennoch gibt es auch beunruhigende Ähnlichkeiten zwischen rechts und links, weil beide Seiten ganz deutlich zwischen Freund und Feind unterscheiden. Auf der einen Seite passiert das, indem Rechte nach starken Führerpersönlichkeiten suchen, was dazu führt, dass sie alle ausschließen, die nicht in das Bild der homogenen Gruppe passen – sei es aufgrund sexueller Identität oder aufgrund der Hautfarbe. Auf der anderen Seite schließen auch die sogenannten Progressiven aus, indem sie Grenzen des Sagbaren festlegen und somit den Feind als moralisch unrein definieren und ausschließen wollen. Dieser Moralismus besteht also in einer völligen Überbetonung von Faktoren wie Betroffensein, Opfersein und der Legitimation eines Rederechts aus diesem Umstand heraus. Das halte ich für anti-aufklärerisch, denn deren große Errungenschaft war doch, dass jeder sprechen darf – ohne Ansehen der Person. Die Inquisitoren aber wünschen sich eine Welt, die vielfältig ist und in der Sexualität und Herkunft keine Rolle mehr spielen sollen, die aber genau diese Punkte, die doch verschwinden sollen, ins Zentrum rücken und am Ende im Namen des Guten und der Gleichheit für einen neuen Separatismus sorgen.
Was würden sie vorschlagen, um dem angestrebten Ziel eines offeneren Diskurses näher zu kommen und ihn weder identitär noch moralisch zu überladen?
Eine zentrale Dehnübung bestünde darin, sich selbst von diesen Begriffen möglichst freizumachen und möglichst diversifiziert zu lesen und wahrzunehmen. Das ist selbstverständlich ein hoher Anspruch, den ich auch durch die Philosophie entwickelt habe. Meine philosophische Sozialisation war zunächst Sartre, gefolgt von einer langen und intensiven Nietzschephase. Später wurde dann die Kritische Theorie durch mein gesamtes Studium hindurch prägend für mich. All diese Lektüre hat mir gezeigt, dass wir ein Impfzentrum unserer selbst werden müssen. Wir müssen uns infizieren mit gefährlichen Stoffen, um mit ihnen umgehen und an ihnen wachsen zu können. Ich habe erst vor einigen Jahren Carl Schmitt entdeckt, den ich für einen brillanten Analytiker halte und den ich mit großem Gewinn gelesen habe. Die Theorie des Ausnahmezustands – hochaktuell – wenn man Schmitt gegen ihn selbst liest. Ein anderes Beispiel wäre Luhmann, der hochaktuell, aber leider etwas vergessen scheint. Er passt einfach nicht in die aufgeladene Stimmung, dabei wäre er ein starkes Gegengift, wenn er z.B. schreibt, es sei die Aufgabe der Ethik, vor der Moral zu warnen. Im Grunde hat Luhmann das Projekt verwirklicht, das Nietzsche mit der Umwertung aller Werte anstrebte, denn Gut und Böse sind bei ihm keine Kategorien mehr. Die Systemtheorie ist eine Hysterie-Blaupause, die die Unschuldsvermutung gelten lässt, weil sie nicht alles sofort aufs Subjekt bezieht. Für einen produktiven Diskurs scheint mir das zentral zu sein.
Letzte Frage Herr Schroeder, wenn Sie heute nochmal ein junger Student der Germanistik und Philosophie wären, würden Sie die Abzweigung auf die Bühne erneut nehmen und Satiriker werden? Oder wäre ihnen der Diskurs zu aufgeheizt, der Spielraum für den Humor zu eng?
Ich neige dazu zu sagen, dass ich es wieder so machen würde. Allerdings finde ich es auch reizvoll darüber nachzudenken, wie der alternative Weg ausgesehen hätte, auch wenn ich mich jetzt in einer sehr luxuriösen Situation befinde: Ich kann als Satiriker immer weitergehen als Journalisten oder als Wissenschaftler, erlege mir aber selbst die Pflicht auf, dass ich nie den einfachen Ausweg nehme und nach einer provokanten Äußerung sage „Huhu, ich bin ja nur Satiriker“. Das finde ich billig. Quatschmachen und provozieren unbedingt, das entbindet aber nicht von Begründungspflicht und Verantwortung. Wenn man hier versucht, genau zu bleiben, kann der Lohn dafür sein, dass man Gedanken in Bereiche der Gesellschaft trägt, die sonst von politischen oder philosophischen Fragen oft weniger mitbekommen. •
Florian Schroeder ist Kabarettist und Autor sowie Radio- und Fernsehmoderator. Er präsentiert unter anderem die „Florian Schroeder Satireshow“ im Ersten und ist Träger des Deutschen Kleinkunstpreises 2021. Jüngst erschien sein Buch „Schluss mit der Meinungsfreiheit!“.
Weitere Artikel
Wie schaffen wir das?
Eine Million Flüchtlinge warten derzeit in erzwungener Passivität auf ihre Verfahren, auf ein Weiter, auf eine Zukunft. Die Tristheit und Unübersichtlichkeit dieser Situation lässt uns in defensiver Manier von einer „Flüchtlingskrise“ sprechen. Der Begriff der Krise, aus dem Griechischen stammend, bezeichnet den Höhepunkt einer gefährlichen Lage mit offenem Ausgang – und so steckt in ihm auch die Möglichkeit zur positiven Wendung. Sind die größtenteils jungen Menschen, die hier ein neues Leben beginnen, nicht in der Tat auch ein Glücksfall für unsere hilf los überalterte Gesellschaft? Anstatt weiter angstvoll zu fragen, ob wir es schaffen, könnte es in einer zukunftszugewandten Debatte vielmehr darum gehen, wie wir es schaffen. Was ist der Schlüssel für gelungene Integration: die Sprache, die Arbeit, ein neues Zuhause? Wie können wir die Menschen, die zu uns gekommen sind, einbinden in die Gestaltung unseres Zusammenlebens? In welcher Weise werden wir uns gegenseitig ändern, formen, inspirieren? Was müssen wir, was die Aufgenommenen leisten? Wie lässt sich Neid auf jene verhindern, die unsere Hilfe derzeit noch brauchen? Und wo liegen die Grenzen der Toleranz? Mit Impulsen von Rupert Neudeck, Rainer Forst, Souleymane Bachir Diagne, Susan Neiman, Robert Pfaller, Lamya Kaddor, Harald Welzer, Claus Leggewie und Fritz Breithaupt.
Die Wurst als Weltformel
Nachdem VW jüngst eine Kantine auf vegetarische Gerichte umstellte, schaltete sich selbst Ex-Kanzler Schröder mit einem Plädoyer für die Currywurst ein. Der Philosoph Harald Lemke erklärt, warum sich an der Wurst so oft moralische Fragen entzünden und weshalb wir einen gastroethischen Hedonismus brauchen.

Florian Werner: „Es gibt eine Sprache der Zunge, die ohne Worte auskommt“
Sie ist Sprachinstrument und Geschmacksorgan, mit ihr küssen wir unsere Liebsten und strecken sie anderen als Zeichen der Missachtung heraus. Im Interview zu seinem neuen Buch Die Zunge erläutert Florian Werner, warum sich der Geist einer Zeit an ihrer Zungenspitze ablesen lässt.

Hegel-Konjunkturen
Die Gesinnung eines Denkers identifiziert man am liebsten zweifelsfrei – Marxist oder Marktliberaler? Staatsdiener oder Freiheitsdenker? Hegel aber ist einmal Feind der Linken, dann der Rechten. Essay über einen Philosophen zwischen den Fronten.
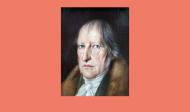
Was heißt hier Meinungsfreiheit, Frau Frick?
Wer über Meinungsfreiheit streiten will, muss erst einmal klären, was eine Meinung überhaupt ist. Was unterscheidet sie von Wissen? Und wann wird sie moralisch problematisch? Ein Interview mit der Philosophin Marie-Luisa Frick.

Florian Rötzer: „Erst die Heimlichkeit des Heims macht uns zu modernen Menschen“
Dass Sein und Wohnen zusammenhängen, dürfte vielen seit dem Beginn der Pandemie noch deutlicher geworden sein. Im Gespräch erläutert der Philosoph Florian Rötzer, was eine denkfreundliche Umgebung ist, wie ein hygienisches Bewusstsein Einzug in unsere vier Wände hielt und warum private Räume immer mehr zum Cockpit werden.

Was heißt hier „rechts“?
Wenige Worte halten sich in der Politik so hartnäckig wie die Rede von „links“ und „rechts“. Zugleich will kaum jemand als „rechts“ gelten. Warum meiden wir den Begriff? Und ist das richtig so?

Sag mir, wo die Rechte ist
Der jüngste Streit über die Sitzordnung im Bundestag wirft eine grundsätzliche Frage auf: Warum sind „links“ und „rechts“ überhaupt so wichtig für unsere Orientierung? Eine Antwort von Florian Werner.
