Höhenfieber
Obschon Skiresorts wie Ischgl im März zu Corona-Hotspots wurden, soll die Wintersportsaison in Österreich und anderen Ländern bald wieder losgehen. Dass trotz angespannter Infektionslage vielerorts so hartnäckig am Schneespaß festgehalten wird, mag nicht nur ökonomische, sondern auch symbolische Gründe haben. Schon 1970 verbuchte der Philosoph Jean Baudrillard Skiorte nämlich als Inbegriff der Konsumgesellschaft.
Philosophie Magazin +

Testen Sie Philosophie Magazin +
mit einem Digitalabo 4 Wochen kostenlos
oder geben Sie Ihre Abonummer ein
- Zugriff auf alle PhiloMagazin+ Inhalte
- Jederzeit kündbar
- Im Printabo inklusive
Sie sind bereits Abonnent/in?
Hier anmelden
Sie sind registriert und wollen uns testen?
Probeabo
Weitere Artikel
Sumana Roy: „Alles um uns herum ist lebendig“
Wenngleich Menschen sich der Pflanzenwelt immer wieder überlegen wähnen, offenbart sich vielerorts auch eine tiefe Sehnsucht nach ihrer Nähe. Die Schriftstellerin Sumana Roy wünschte sich sogar, so zu leben wie ein Baum. Im Gespräch spricht sie über ihre Begegnungen mit der nichtmenschlichen Welt und ein Denken, das ohne Binaritäten auskommt.

Das Unantastbare retten
In ihrem Essay Klinik der Würde untersucht die Philosophin und Psychoanalytikerin Cynthia Fleury, warum das Leben vielerorts immer unwürdiger wird, während man Würde deutlicher einklagt als je zuvor.
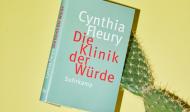
Der Diesel in uns
Die Panik, die die drohenden Diesel-Fahrverbote vielerorts auslösen, zeigt eines deutlich: Mehr als wir denken hat das Auto mit unserem Selbstverständnis als moderne Individuen zu tun
Die Nacht der Hexen
Am 30. April feiert man vielerorts die Walpurgisnacht. Einst eine keltische Tradition, ganz ohne Hexen, hat sie einen Wandel durchlaufen, der auch mit männlichen Machtstrukturen zusammenhängt.

Was weiß mein Körper?
Die Frage irritiert. Was soll mein Körper schon wissen? Ist das Problem denn nicht gerade, dass er nichts weiß? Weder Vernunft noch Weisheit besitzt? Warum sonst gibt es Gesundheitsratgeber, Rückenschulen, Schmerztabletten, viel zu hohe Cholesterinwerte. Und wieso gibt es Fitness-Tracker, diese kleinen schwarzen Armbänder, die ihrem Träger haargenau anzeigen, wie viele Meter heute noch gelaufen, wie viele Kalorien noch verbrannt werden müssen oder wie viel Schlaf der Körper braucht. All das weiß dieser nämlich nicht von selbst – ja, er hat es bei Lichte betrachtet noch nie gewusst. Mag ja sein, dass man im 16. Jahrhundert von ganz allein ins Bett gegangen ist. Aber doch wohl nicht, weil der Körper damals noch wissend, sondern weil er von ruinöser Arbeit todmüde und es schlicht stockdunkel war, sobald die Sonne unterging. Wer also wollte bestreiten, dass der Körper selbst über kein Wissen verfügt und auch nie verfügt hat? Und es also vielmehr darum geht, möglichst viel Wissen über ihn zu sammeln, um ihn möglichst lang fit zu halten.
Europas neuer Jugendstil
In Österreich könnte bald ein 31-Jähriger Bundeskanzler werden. Nicht nur hier stellt sich die Frage: Stehen die Jungen auch für eine neue Politik?
Gernot Blümel, der Wiener ÖVP-Vorsitzende, der gute Chancen hat, in die nächste österreichische Regierung als Minister einzurücken, kokettiert gern damit, dass er mit 35 in seiner Partei schon zum alten Eisen gehört.
Zusammenbruch der Zeichen
Die Kryptowährung Dogecoin begann als Parodie auf den Marktführer Bitcoin. Nicht zuletzt dank Elon Musk entwickelte sich die Satire zum ernstzunehmenden Konkurrenten. Aus der Perspektive des Philosophen Jean Baudrillard birgt das auch eine Gefahr: Es droht ein Kollaps der Zeichen.

Judith Butler und die Gender-Frage
Nichts scheint natürlicher als die Aufteilung der Menschen in zwei Geschlechter. Es gibt Männer und es gibt Frauen, wie sich, so die gängige Auffassung, an biologischen Merkmalen, aber auch an geschlechtsspezifischen Eigenschaften unschwer erkennen lässt. Diese vermeintliche Gewissheit wird durch Judith Butlers poststrukturalistische Geschlechtertheorie fundamental erschüttert. Nicht nur das soziale Geschlecht (gender), sondern auch das biologische Geschlecht (sex) ist für Butler ein Effekt von Machtdiskursen. Die Fortpf lanzungsorgane zur „natürlichen“ Grundlage der Geschlechterdifferenz zu erklären, sei immer schon Teil der „heterosexuellen Matrix“, so die amerikanische Philosophin in ihrem grundlegenden Werk „Das Unbehagen der Geschlechter“, das in den USA vor 25 Jahren erstmals veröffentlicht wurde. Seine visionäre Kraft scheint sich gerade heute zu bewahrheiten. So hat der Bundesrat kürzlich einen Gesetzesentwurf verabschiedet, der eine vollständige rechtliche Gleichstellung verheirateter homosexueller Paare vorsieht. Eine Entscheidung des Bundestags wird mit Spannung erwartet. Welche Rolle also wird die Biologie zukünftig noch spielen? Oder hat, wer so fragt, die Pointe Butlers schon missverstanden?
Camille Froidevaux-Metteries Essay hilft, Judith Butlers schwer zugängliches Werk zu verstehen. In ihm schlägt Butler nichts Geringeres vor als eine neue Weise, das Subjekt zu denken. Im Vorwort zum Beiheft beleuchtet Jeanne Burgart Goutal die Missverständnisse, die Butlers berühmte Abhandlung „Das Unbehagen der Geschlechter“ hervorgerufen hat.