Was ist wahre Freundschaft?
Es ist bekanntlich nicht wichtig, viele Freunde zu haben, solange es die richtigen Freunde sind. Doch woran erkennt man die? Drei Antworten von Michel de Montaigne, Immanuel Kant und Hannah Arendt.
Michel de Montaigne
(1533–1592)
„Wahre Freundschaft ist Verschmelzung“
In seinem Essay Über die Freundschaft beschreibt Montaigne die wahre Freundschaft als absolute Einheit zweier Menschen und mahnt: „Dass man mir die gewöhnliche Freundschaft ja nicht auf die selbe Stufe stelle!“ Gewöhnliche Freundschaft entstünde nämlich aus einer Zweck-Nutzen-Logik heraus. Dagegen würden wir wahre Freunde nicht aufgrund ihrer hilfreichen oder liebenswerten Eigenschaft wählen, sondern um ihrer selbst willen. In einer so bedingungslosen Freundschaft verschmelzen zwei Personen zu einer Seele und einem Willen so, dass „sie sogar die Naht nicht mehr finden, die sie eint“. Und da wahre Freunde ein Teil des eignen Ichs werden, kann man ihnen mindestens genauso vertrauen wie sich selbst.
Immanuel Kant
(1724–1804)
„Freunde können über (fast) alles reden“
Kant unterscheidet drei Arten der Freundschaft: die des Nutzens, des Geschmacks und der Gesinnung, wobei er Letztere als die wichtigste einschätzt. Freunde mit gleicher Gesinnung haben nicht die gleiche Meinung, sondern die gleichen Prinzipien. Weil sie sich auf das Wohlwollen des anderen verlassen können, vertrauen wahre Freunde sich einander an und können steife Höflichkeiten hinter sich lassen. Ihr offener Austausch wird zur „Zuflucht“ in einer Welt, in der wir anderen oft misstrauen. Ein Mindestmaß an Diskretion sieht Kant aber selbst hier geboten: „Man muß sich seinem besten Freunde nicht so entdecken, als man natürlich ist und sich kennt, denn sonst würde das ekelhaft sein.“
Hannah Arendt
(1906–1975)
„Wahre Freundschaft ist politisch“
Für Hannah Arendt zeigt sich der Wert einer Freundschaft im Gespräch. Wahre Freunde reden weniger über ihr privates Seelenleben als über die Welt, die sie miteinander teilen. Und insofern es in Gesprächen zwischen Freunden um die geteilte Welt und ihre gemeinsamen politischen Anliegen geht, ist auch ihre Freundschaft politisch. Das bedeutet zum einen, dass sie eine Grundlage für politisches Handeln bietet: Aus Freundschaft kann Komplizenschaft entstehen. Zum anderen hilft der Austausch mit Freunden dabei, die Welt besser zu verstehen und seine Meinung zu schärfen. Ob die politische Freundschaft auch immer harmonisch ist, ist für Arendt zweitrangig. Denn wahre Freunde müssen sich nicht gleichen, solange sie im Diskurs zueinanderfinden und die Haltung ihres Gegenübers respektieren. •
Weitere Artikel
Michel de Montaigne – Unterwegs zu einem besseren Ich
Angesehener Diplomat, sinnenfroher Lebemann, stoischer Privatgelehrter. Michel de Montaigne – der heute vor 432 Jahren gestorben ist – ist so vielschichtig wie seine Schriften. Kein Wunder, war sein bevorzugtes philosophisches Thema doch er selbst.

Seyla Benhabib: „Von Arendt lässt sich lernen, wie man über Politik noch mit Hoffnung nachdenken kann“
In New York, wo Hannah Arendt nach ihrer Flucht bis zu ihrem Tod lehrte und lebte, treffen wir die Philosophin Seyla Benhabib. Sie ist mit Arendts Werk tief vertraut und erhält im Dezember den renommierten Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken. Wie hätte Arendt die Krisen unserer Zeit gedeutet? Wie hätte sie auf das Freund-Feind-Denken im Diskurs geschaut? Ein Gespräch über Hannah Arendt im Lichte der Gegenwart.

Kant und der Geschmack
Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Auch Kant war der Überzeugung, dass unsere ästhetischen Urteile subjektiv und nicht rational sind. Dennoch erwarten wir die Zustimmung unserer Mitmenschen, wenn wir etwas schön finden. Wieso?

Woran erkennen Sie, dass Sie alt geworden sind?
Man ist nach dem Treppenstiegen außer Atem, erzählt immer öfter dieselben Geschichten oder scheitert an neuen Smartphone-Apps: Sind das schon Anzeichen dafür, dass man alt wird? Nicht unbedingt. Denn Rousseau, Cicero und Montaigne machten dafür drei andere Anzeichen aus.

Immanuel Kant und synthetische Urteile
Wie sind synthetische Urteile a priori möglich? Immanuel Kant weiß die Antwort – aber Sie verstehen schon die Frage nicht? Wir helfen in unserer Rubrik Klassiker kurz erklärt weiter!

Immanuel Kant: „Der Mensch ist das einzige Tier, das arbeiten muss“
Ist Arbeit eine Notwendigkeit, ein Vergnügen oder eine Pflicht? Immanuel Kant hat sich für die dritte Option entschieden. Es folgt eine Erklärung, ausgehend von einem Zitat aus Über Pädagogik.

Die neue Sonderausgabe: Freundschaft
Die Kraft der Freundschaft ist zeitlos. Doch gerade in Phasen des Umbruchs gewinnt sie besondere Bedeutung. Freundschaft stabilisiert, wenn alles andere in Bewegung gerät.
Hier geht's zur umfangreichen Heftvorschau!
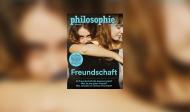
Kant, Nietzsche und Hegel über den Krieg
Wie hätten sich die drei Philosophen Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche und Georg Wilhelm Friedrich Hegel zum Krieg in der Ukraine verhalten? In seinem fiktionalen Bargespräch lässt Alexandre Lacroix die drei Geistesgrößen in Königsberg aufeinandertreffen.
