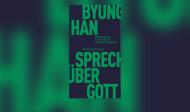Spinozas Begriff der Natur
Baruch de Spinoza unterscheidet zwischen „schaffender Natur“, die er mit Gott gleichsetzt, und „geschaffener Natur“. Was hat das zu bedeuten? Wir helfen weiter!
Die Relevanz
Zu Spinozas Zeiten wie auch heute noch glauben viele Menschen an einen transzendenten Schöpfergott. Sie fürchten Gottes „Strafen“ und hoffen, ihn durch Gebete positiv beeinflussen zu können. In Spinozas Augen ist das Aberglaube. Gott ist keine Person, sondern die Gesamtheit der Natur. Nicht Transzendenz, sondern reine Immanenz. Diese Auffassung hat Konsequenzen für unsere Lebenspraxis: Statt zu beten, gilt es, die Gesetze der Natur, der Logik und der Psychologie zu verstehen. So überwinden wir unsere begrenzte Sichtweise und irrationalen Affekte. Spinozas Ansichten führten zur Verbannung aus seiner jüdischen Gemeinde, begeisterten später jedoch unter anderem Goethe, Schelling und Hegel. Noch heute wirken sie erstaunlich modern.
Das Zitat
„(Es) ergibt sich (…), dass wir unter ,schaffende Natur‘ das zu verstehen haben, was in sich ist und durch sich begriffen wird, oder solche Attribute der Substanz, welche ewiges und unendliches Wesen ausdrücken, d. h. (…) Gott, sofern er als freie Ursache betrachtet wird. Unter ,geschaffene Natur‘ aber verstehe ich alles dasjenige, was aus der Notwendigkeit der Natur Gottes folgt, d. h. alle Daseinsformen (Modi) der Attribute Gottes, sofern sie als Dinge betrachtet werden, welche in Gott sind und welche ohne Gott weder sein noch begriffen werden können.“
„Ethik“, Lehrsatz 29, Anmerkung (1677)
Die Erklärung
Spinoza identifiziert Gott und Natur, nimmt aber eine feine Unterscheidung vor: Im tieferen Sinn ist Gott die „schaffende Natur“: Das aktive, verursachende Prinzip aller Dinge. Gott hat unendliche „Attribute“, das heißt Seinsweisen, von denen der Mensch nur zwei erkennt: Denken und Ausdehnung. Aus den Attributen folgen direkt die grundlegenden Gesetze des Kosmos. Aus der Ausdehnung ergeben sich etwa die Gesetze der Physik. Indirekt folgen auch die Einzeldinge, die „geschaffene Natur“ (etwa Bäume und Katzen) kausal notwendig aus Gott. Letztlich sind alle Dinge „in Gott“, alles geschieht notwendig, alles ist determiniert. Umstritten ist, ob Spinozas Gleichsetzung von Gott und Natur nicht eigentlich Atheismus bedeutet. •
Weitere Artikel
Spinoza und die Lebenslust
Entgegen dem Zeitgeist entwarf Baruch de Spinoza, dessen Geburtstag sich heute zum 391. Mal jährt, ein Menschenbild, in dem die vernunftgeleitete Maximierung der Lebenslust im Mittelpunkt steht. Es hat bis heute nichts von seiner Aktualität verloren.

Pierre Zaoui: „Man muss seinem Begehren treu sein“
Geglückte Veränderung hieß für den niederländischen Denker Baruch de Spinoza (1632–1677) nicht, sich neu zu erfinden. Ganz im Gegenteil forderte er dazu auf, „in seinem Sein zu beharren“. Der Spinoza-Experte Pierre Zaoui erklärt, was damit gemeint ist.

Wie echt sind falsche Diamanten?
Eines der weltweit größten Schmuckunternehmen hat angekündigt, künftig nur noch synthetisch hergestellte Diamanten zu vertreiben. Schließlich seien diese von vergleichbarer Reinheit, dafür aber umweltschonender. Doch sind sie damit auch „echt“? Der Philosoph Baruch de Spinoza kann weiterhelfen.

Angelika Neuwirth: „Der Koran ist vielstimmig“
Nach traditionellem muslimischen Verständnis ist der Koran zur Gänze Gottes Wort. Aber auch die klassische islamische Korankunde untersucht die einzelnen Teile auf ihre Entstehungszeit und unterscheidet zwischen früheren, mekkanischen, und späteren, medinischen Suren. Die große Koranforscherin Angelika Neuwirth erläutert, wie sich in der zeitlichen Abfolge der Suren eine theologische Diskussion nachverfolgen lässt, die christliche, jüdische und alte arabische Einflüsse aufnimmt und weiterentwickelt.

Pico della Mirandola und der Mensch
Wir Menschen leben unter der Bedingung, „dass wir das sein sollen, was wir sein wollen“, meint der Renaissance-Denker Pico della Mirandola. Was das bedeuten soll? In unserer Rubrik Klassiker kurz erklärt helfen wir weiter.

Hegel und das Selbstbewusstsein
Für Georg Wilhelm Friedrich Hegel ist das Selbstbewusstsein „die Mitte“, jedoch „in die Extreme zersetzt“. Was das bitte wieder bedeuten soll? Wir helfen weiter.

„Wir haben die Pflicht, Sinn zu stiften“
Reinhold Messner ist einer der letzten großen Abenteurer der Gegenwart. Mit seiner Ehefrau Diane hat er ein Buch über die sinngebende Funktion des Verzichts geschrieben. Ein Gespräch über gelingendes Leben und die Frage, weshalb die menschliche Natur ohne Wildnis undenkbar ist.

Byung-Chul Han: Sprechen über Gott
In seinem neuen Buch Sprechen über Gott denkt Byung-Chul Han mit der französischen Mystikerin Simone Weil noch einmal neu über Themen nach, die ihn seit langem beschäftigen – etwa der allgemeine Verfall der Aufmerksamkeit sowie die Bedeutung der Schönheit und des Schmerzes. Wer sich auf das Buch einlässt, erfährt Wesentliches über unsere Gegenwart und Wege, die zu Gott führen.