Unter Spannung – Zum 800. Geburtstag des Synthetisierers Thomas von Aquin
Thomas von Aquin gehörte zu den großen Philosophen des Mittelalters. Sein Denken schlug eine Brücke zwischen Vernunft und Glauben, Begründung und Autorität. Vor 800 Jahren wurde Thomas im mittelitalienischen Roccasecca geboren.
Philosophie Magazin +

Testen Sie Philosophie Magazin +
mit einem Digitalabo 4 Wochen kostenlos
oder geben Sie Ihre Abonummer ein
- Zugriff auf alle PhiloMagazin+ Inhalte
- Jederzeit kündbar
- Im Printabo inklusive
Sie sind bereits Abonnent/in?
Hier anmelden
Sie sind registriert und wollen uns testen?
Probeabo
Weitere Artikel
Wer war Thomas Mann? Sechs philosophische Deutungen
Thomas Manns Romane und Erzählungen vereinen Realismus und Romantik, Humanismus und Sozialismus, Spielerei und Platonismus. Heute vor 150 Jahren wurde der Dichterphilosoph geboren.

Donna Haraway: „Wir müssen lernen, mit dem Mehr-als-Menschlichen in Kontakt zu treten“
Donna Haraway inspirierte Generationen dazu, neue, kreative Arten der Koexistenz von Mensch, Natur und Technik zu entwerfen. Ihr Denken bewegt sich zwischen Thomas von Aquin, Science-Fiction und Hundetraining. Eine Begegnung unter Bäumen.
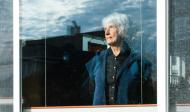
Donna Haraway: „Wir müssen lernen, mit dem Mehr-als-Menschlichen in Kontakt zu treten“
Donna Haraway ist eine der einflussreichsten und innovativsten Philosophinnen unserer Zeit. Ihr feministisch-ökologisches Denken bewegt sich zwischen Thomas von Aquin, Evolutionstheorie, Science-Fiction und Hundetraining. Eine Begegnung unter Bäumen.

Autorität in Zeiten von Corona
Krisenzeiten schärfen die Wahrnehmung. Etwa darauf, was wirklich „systemrelevante“ Berufe sind. Aber auch, wie Autorität funktioniert, lässt sich in Zeiten von Corona klarer beobachten. Ein Denkanstoß von Catherine Newmark.

Verteidigung der Autorität
Autorität als Konzept hochzuhalten, gilt als konservativ, gar antidemokratisch. Ein folgenschwerer Irrtum, argumentiert Sebastian Kleinschmidt. Vielmehr ist sie es, die uns vor der Blindheit des Gruppenzwangs bewahrt.

Thomas Müntzer und die Geburt des Kommunismus aus dem Geist der Mystik
Heute vor 500 Jahren wurde Thomas Müntzer in Mühlhausen hingerichtet. Als Rivale Martin Luthers trat er an der Seite der Bauern im Kampf gegen die Knechtschaft an. Sein mystischer Kommunismus könnte auch heute noch in die Zukunft weisen.

Thomas Wagner: „In der Welt des Denkens gibt es immer Berührungspunkte“
Zeitlebens warnte der jüdische Denker Theodor W. Adorno, der in den 1930ern selbst ins Exil floh, vor der Bedrohung des Faschismus. Aus welchem Grund suchte er im Nachkriegsdeutschland den engen Austausch mit seinem konservativen Kollegen Arnold Gehlen, einem ausgewiesenen Unterstützer der Nationalsozialisten? Thomas Wagner über ideologische Gräben und intellektuelle Verbundenheit.

Nora Bossong: „Ich hoffe, dass diese Generation eine Brücke baut zwischen den Boomern und der Klimajugend“
In ihrem heute erscheinenden Buch Die Geschmeidigen zeichnet Nora Bossong ein politisches Porträt ihrer Generation. Ein Gespräch über Angepasstheit, den „neuen Ernst des Lebens“ und vernünftige Visionen.
