Franck Fischbach: „Der Kapitalismus schafft Menschen, die nicht mehr wirklich sozial sind“
Der Philosoph Franck Fischbach lässt sich von Marx und der deutschen Ideologie inspirieren, um eine neue Kritik der Arbeit und der Auswirkungen des Kapitalismus auf unsere Gesellschaften zu formulieren. Ein Gespräch.
Herr Fischbach, während sich Ihre ersten Arbeiten mit dem deutschen Idealismus befassen, konzentrieren sich Ihre neueren Werke eher auf die Arbeit. Wie kam es zu diesem doppelten Interesse?
Ich habe tatsächlich als Philosophiehistoriker angefangen und mich auf die deutsche Philosophie spezialisiert. Aber meine Lektüre der klassischen deutschen Philosophen (Hegel, Schelling, Fichte) war nie losgelöst von den sozialen und politischen Herausforderungen unserer Zeit: Ich war von Anfang an der Meinung, dass Hegels Grundlinien der Philosophie des Rechts (1820) oder Fichtes Beitrag zur Berichtigung der Urtheile des Publicums über die französische Revolution (1793) Ressourcen bieten, um über die politischen und sozialen Herausforderungen unserer Zeit nachzudenken. Mir war von Anfang an bewusst, dass Hegels Linie über Marx und die Kritische Theorie der Frankfurter Schule in unsere Zeit führt. Umso mehr, als ich zur gleichen Zeit, also Anfang der 1990er Jahre, das Werk des jüngsten Vertreters der Frankfurter Schule, Axel Honneth, entdeckte, dessen Denken sich damals, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von Kampf um Anerkennung, als „Rückkehr zu Hegel” präsentierte – nach der „Rückkehr zu Kant” durch den wichtigsten Vertreter (vor Honneth) derselben Tradition, nämlich Jürgen Habermas. So entstand eine Verbindung zwischen „meinen” klassischen deutschen Autoren und dem zeitgenössischen sozialen Denken. Wenn man dazu noch die Zeit hinzufügt, in der wir Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre lebten, nämlich eine Zeit, die sowohl von der neoliberalen Globalisierung als auch von globalisierungskritischen Kämpfen geprägt war, ergibt sich ein Kontext, der mich zu Marx als einem Denker führte, den ich sowohl als Fortführer der klassischen deutschen Philosophie als auch als Inspirator der kritischen Gesellschaftstheorie lesen konnte: An der Schnittstelle dieser beiden Dimensionen stand die Frage der „Arbeit” und der neuen „Entfremdungen” in der Arbeit.
Sie sind insbesondere für Ihr 2016 erschienenes Manifest für eine Sozialphilosophie bekannt. Worin besteht diese Philosophie?
Während der Begriff „Sozialphilosophie” im französischen Denken des späten 18. Jahrhunderts verwurzelt ist und zeitgleich mit der Französischen Revolution entstand, blieb die Sozialphilosophie als solche in Frankreich lange Zeit weitgehend im Verborgenen, während sie in anderen nationalen Traditionen, insbesondere in Deutschland, klar identifiziert wurde. Ohne als solche identifiziert zu werden, existierte die Sozialphilosophie in Frankreich dennoch als eine Art, Philosophie zu betreiben, indem man sich sowohl über die Ergebnisse der Sozialwissenschaften informierte, als auch eine bewertende und normative Dimension offen hielt. Diese Dimension ermöglicht eine Kritik dessen, was in den bestehenden Gesellschaften in Form von Herrschafts- und/oder Ausbeutungsverhältnissen der Möglichkeit eines würdigen und erfüllten menschlichen Lebens für die Mehrheit entgegensteht. Die Sozialphilosophie hat somit in Frankreich verschiedene philosophische Traditionen beeinflusst, insbesondere den Marxismus in seinen heterodoxen Formen (mit Henri Lefebvre, Cornelius Castoriadis, Guy Debord) und die Phänomenologie (bei Beauvoir, Sartre oder auch Merleau-Ponty).
Philosophen wird manchmal vorgeworfen, zu abgehoben zu sein. Würden Sie sagen, dass die Philosophie die Soziologie braucht, um sich der Wahrheit anzunähern?
Das hängt ganz davon ab, mit welchen Themen sich der Philosoph beschäftigt. Wenn er sich mit rein metaphysischen Fragen befasst, ist die Tatsache, dass er „abgehoben” ist, wie Sie sagen, sicherlich nicht sehr störend. Sobald sich der Philosoph jedoch mit Realitäten befasst, die Gegenstand anderer Disziplinen sind, ist es das Mindeste, die Ergebnisse dieser anderen Disziplinen zu berücksichtigen und sich sogar anzueignen: Das gilt für einen Philosophen der Ästhetik, bei dem man sich nicht vorstellen kann, wie er Arbeiten von Kunsthistorikern ignorieren könnte. Dies gilt auch für den Bereich der Wissenschaftsphilosophie: Wie könnte ein Philosoph etwas auch nur annähernd Ernsthaftes zu diesem Thema sagen, wenn er den Stand der Wissenschaften seiner Zeit nicht kennt? Das Gleiche gilt für die Sozialphilosophie: Als Philosoph kann man keine ernsthaften Aussagen über soziale Lebensformen oder soziale Beziehungen treffen, wenn man keine Kenntnisse in Soziologie, Wirtschaftstheorie, Anthropologie, aber auch in Gender- und Race-Studies hat. Und wie würde eine Sozialphilosophie aussehen, die um einen ökologischen Aspekt ergänzt wird und vorgibt, ohne jegliche Verankerung in den Umwelt- und Geowissenschaften auszukommen?
Unsere Zeit durchlebt eine schwere Krise in Bezug auf die Arbeit: Sinnverlust, Bedrohung durch KI, Burn-out... Inwiefern lässt sich mit Ihrer „Kritik der Produktion” dieser Wandel erklären?
Ich denke, dass die Frage der Arbeit wie ein Bumerang zurückgekommen ist: Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre glaubte man, mit der Arbeit abgeschlossen zu haben, sodass man sogar vom „Ende der Arbeit” sprechen konnte (Jeremy Rifkin). Bis man begriff, dass der wahre Sinn der Veränderungen in der Arbeitswelt seit Anfang der 1980er Jahre nicht darin bestand, dank Technologie ihr Ende herbeizuführen, sondern die Ausbeutung der menschlichen Arbeitskraft mit neuen Managementtechniken zu intensivieren. Im Versuch, etwas zu verstehen, das nicht nur nicht das Ende der Arbeit war, sondern im Gegenteil die Rückkehr der Ausbeutung in neuer Form, ging ich zu Marx zurück und stieß auf eine Unterscheidung zwischen „Arbeit” und „Produktion”, die mir sehr nützlich erschien – eine Unterscheidung, zu der Marx selbst gelangte, als er die Idee einer Abschaffung der Arbeit aufgegeben hatte. Dies ermöglichte es ihm, sich der Frage zu nähern, was mit den menschlichen Arbeitstätigkeiten und denjenigen, die arbeiten, geschieht, wenn sie dem unterworfen sind, was ich als „Produktionsimperativ” bezeichne. Produktionsimperative sind Prozesse, die dazu führen, dass die qualitative Dimension der geleisteten Arbeit (die Marx als ihren „Gebrauchswert” bezeichnete) negiert und Arbeit nur noch als Mittel zur quantitativen Wertakkumulation betrachtet wird.
Inwiefern ist Marx' Denken, das von einigen aktuellen Autoren kritisiert oder heruntergespielt wird, Ihrer Meinung nach noch aktuell?
Ich würde sagen, dass Marx' Denken heute viel weniger heruntergespielt wird als früher, vor allem in den 1980er und 90er Jahren: Seitdem hat es eine echte „Marx-Renaissance” gegeben, insbesondere aufgrund der Tatsache, dass sich die Widersprüche der kapitalistischen Produktionsweise so stark verschärft haben, dass sie selbst für die Verfechter dieser Produktionsweise und dieser sozialen Ordnung kaum noch zu leugnen sind. Natürlich gab es die Finanzkrise von 2007-2008, aber viel grundlegender ist: Die kapitalistische Produktionsweise erscheint immer offensichtlicher als diejenige, die den Ast absägt, auf dem alle menschlichen Gesellschaften sitzen, oder die die grundlegende Existenzbedingung aller menschlichen Gesellschaften leugnet: Ihre eigene natürliche Umwelt und damit die Ressourcen und biogeochemischen Bedingungen, ohne die kein menschliches Sozialleben möglich ist.
Können Sie das ausführen? Inwiefern ist unser Sozialleben durch den Kapitalismus bedroht?
Es geht mir dabei um den „sozialen Kern” unserer Gesellschaften. Dieser soziale Kern setzt die Existenz von Menschen voraus, deren Leben nicht voneinander getrennt oder losgelöst werden können, also auch von Individuen, die in der Lage sind, Beziehungen zu pflegen. Das betrifft nicht nur Beziehungen untereinander, sondern auch zu dem, was in ihrer natürlichen Umgebung die Bedingungen ihres Lebens ausmacht. Diese grundlegenden sozialen Beziehungen sind untrennbar mit allen Aktivitäten verbunden, durch die Menschen ihr Leben und ihre Lebensbedingungen reproduzieren. Ich glaube, dass es dieser soziale Kern ist, dessen Existenz durch die Formen der fortgesetzten kapitalistischen Entwicklung bedroht ist: Sie neigt dazu, diese Bindungen zu zerstören, ihre Pflege zu verhindern, und Wesen zu schaffen, die nicht mehr wirklich sozial und damit auch nicht mehr wirklich menschlich sind.
Ist der Kern des Problems ein „grundlegender Widerspruch zwischen wirtschaftlicher Produktion und sozialer Reproduktion“, der zu einem Gefühl der Verhinderung des kollektiven Handelns führt?
Jede menschliche Gesellschaft steht vor der Notwendigkeit, sich als Gesellschaft zu reproduzieren, d. h. in ihrem Dasein zu bestehen. In Gesellschaften, die zeitlich vor den kapitalistischen existierten, war wirtschaftliche Produktion der Reproduktion der Gesellschaft untergeordnet. Es wurden Dinge produziert, deren Zweck darin bestand, die sozialen Bedürfnisse der einzelnen Mitglieder der Gesellschaft zu befriedigen – eine Bedürfnisbefriedigung, die es dieser Gesellschaft ermöglichte, über die Zeit hinweg zu bestehen, d. h. sich zu reproduzieren. Die kapitalistische Funktionsweise ist durch die Umkehrung dieses Verhältnisses gekennzeichnet: Die soziale Reproduktion ist nun der wirtschaftlichen Produktion untergeordnet. Mit anderen Worten: Die wirtschaftliche Produktion hat sich von der sozialen Reproduktion emanzipiert. Diese grundlegende Veränderung wurde dadurch ermöglicht, dass die Produktion selbst eine wesentliche Veränderung erfahren hat: Sie zielt nicht mehr in erster Linie auf die Produktion von Gütern und Dienstleistungen ab, die der Befriedigung sozialer Bedürfnisse dienen, sondern auf die Produktion von Wertgegenständen, d. h. von Waren, deren Kauf und Verkauf die Vermehrung des akkumulierten Werts ermöglichen. Die Beziehungen, die Menschen miteinander eingehen, um ihr Leben zu reproduzieren und die Bedingungen für diese Reproduktion zu gewährleisten, sind daher nicht mehr wesentlich: Wesentlich sind die Tauschbeziehungen. Im Mittelpunkt unserer Gesellschaften stehen nicht die komplementären Beziehungen der Menschen untereinander als soziale Wesen, sondern die Warenaustauschbeziehungen – was bedeutet, dass den qualitativen zwischenmenschlichen Beziehungen Austauschbeziehungen auferlegt werden, die selbst einer rein quantitativen Logik der Anhäufung untergeordnet sind.
Sie unterscheiden, in Anlehnung an John Dewey, zwischen „Gemeinschaft bilden” und „Gesellschaft bilden”. Müssen wir heute die Idee der Gemeinschaft aufgeben?
Nein, wir sollten die Idee der Gemeinschaft nicht aufgeben, im Gegenteil! Diese Idee kann noch immer einen wünschenswerten Horizont eröffnen, unter zwei Bedingungen: Sie darf nicht als Rückkehr zu vormodernen Gesellschaften verstanden werden. Und sie muss mit einem „gemeinsamen Handeln” verbunden sein. Anstelle direkter sozialer Beziehungen von Angesicht zu Angesicht, die für vormoderne Gemeinschaften charakteristisch waren, haben moderne Gesellschaften soziale Beziehungen geschaffen, die im Wesentlichen darin bestehen, Individuen miteinander in Kontakt zu bringen und zu verbinden, also Interaktionen, in denen sich Individuen wiederfinden, ohne dies gewollt zu haben. Zwar haben diese unpersönlichen sozialen Beziehungen den Vorteil, dass sie den Individuen die Notwendigkeit nehmen, ihre sozialen Beziehungen und den gegenseitigen Austausch, auf dem das soziale Leben beruht, ständig aufrechtzuerhalten. Aber gleichzeitig entwöhnen sie sie davon, dies zu tun, oder hindern sie sogar daran. In modernen Gesellschaften können Individuen ein soziales Ganzes bilden, ohne jedoch etwas zusammen tun zu müssen. Da sie jedoch nichts mehr zusammen tun müssen, zerfällt die Gesellschaft, insbesondere wenn sie gleichzeitig den Angriffen der kapitalistischen Produktions- und Akkumulationslogik ausgesetzt ist. Das ist der Punkt, an dem wir stehen: Die Folgen dieses ungewollten, unorganisierten „assoziativen Verhaltens” sind heute so negativ (für unser Leben und für das Leben insgesamt), dass es dringend notwendig ist, von einfachen sozialen Interaktionen zu einer „Aktionsgemeinschaft” (Dewey) überzugehen – von Beziehungen zu Verbindungen, von nur kombinierten Aktionen zu wirklich gegenseitigen Aktionen.
Wie können wir „gemeinsam neu beginnen”, wenn die extreme Rechte überall auf der Welt droht und die digitale Wirtschaft sowohl die sozialen Beziehungen als auch die menschlichen Aktivitäten zerstört?
Es muss klar gesagt werden, dass die extreme Rechte ein Projekt der Zerstörung sozialer Beziehungen verfolgt, wie Sie es sehr treffend formuliert haben. Deshalb bringt sie überall, wo sie auftritt, Chaos in die Gesellschaft: Sie ist die Ursache für soziale Unruhen. Die extreme Rechte und der Faschismus (alt und neu) stehen für das Gegenteil von „gemeinsam tun“: Sie behaupten, dass Menschen zu unterschiedlich sind, um noch gemeinsam etwas tun zu können, dass man daher zu Gemeinschaften ohne Unterschiede zurückkehren muss – dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Gemeinsames Handeln setzt die Komplementarität der Individuen untereinander voraus. Individuen können sich jedoch nur dann ergänzen, d. h. komplementär zueinander sein, wenn sie sich unüberwindbar voneinander unterscheiden! Deshalb muss man sich – um die extreme Rechte zu bekämpfen – nicht auf irgendeine Theorie stützen, deren Abstraktheit zur Ohnmacht führt, sondern auf Praktiken, die diese Komplementarität zwischen ungleichen Individuen durch Erfahrung belegen. Diese Praktiken sind alltäglich, sie finden beispielsweise am Arbeitsplatz statt, wenn es nicht mehr darum geht, wer was ist oder wer woher kommt, sondern wer was tut. Meint: wer über ein bestimmtes Know-how verfügt, das das Know-how der anderen ergänzt. •
Franck Fischbach ist Professor für Philosophie an der Universität Panthéon-Sorbonne in Paris. Er arbeitet insbesondere zur deutschen Philosophie und ist Begründer einer eigenen Sozialphilosophie in Frankreich.
Weitere Artikel
Es kam so überraschend wie verheerend.
Das Coronavirus, das die Welt Anfang 2020 erfasste und in vielen Bereichen noch immer unseren Alltag bestimmt, erzeugte vor allem eines: ein globales Gefühl der Ungewissheit. Wurde das soziale Leben in kürzester Zeit still gestellt, Geschäfte, Kinos und Bars geschlossen und demokratische Grundrechte eingeschränkt, blieb zunächst unklar, wie lange dieser pandemische Ausnahmezustand andauern würde. Und selbst jetzt, da sich das Leben wieder einigermaßen normalisiert zu haben scheint, ist die Unsicherheit nach wie vor groß: Wird es womöglich doch noch eine zweite Infektionswelle geben? Wie stark werden die wirtschaftlichen Auswirkungen des Shutdowns sein? Entwickeln sich Gesellschaften nun solidarisch weiter oder vollziehen sie vielmehr autoritären Rollback? Ganz zu schweigen von den individuellen Ungewissheiten: Kann ich im Sommer in den Urlaub fahren? Werde ich im Herbst noch Arbeit haben? Hält die Beziehung der Belastung stand? Kurzum: Selten war unsere so planungsbedürftige Zivilisation mit so viel Ungewissheit konfrontiert wie derzeit.

Wie schaffen wir das?
Eine Million Flüchtlinge warten derzeit in erzwungener Passivität auf ihre Verfahren, auf ein Weiter, auf eine Zukunft. Die Tristheit und Unübersichtlichkeit dieser Situation lässt uns in defensiver Manier von einer „Flüchtlingskrise“ sprechen. Der Begriff der Krise, aus dem Griechischen stammend, bezeichnet den Höhepunkt einer gefährlichen Lage mit offenem Ausgang – und so steckt in ihm auch die Möglichkeit zur positiven Wendung. Sind die größtenteils jungen Menschen, die hier ein neues Leben beginnen, nicht in der Tat auch ein Glücksfall für unsere hilf los überalterte Gesellschaft? Anstatt weiter angstvoll zu fragen, ob wir es schaffen, könnte es in einer zukunftszugewandten Debatte vielmehr darum gehen, wie wir es schaffen. Was ist der Schlüssel für gelungene Integration: die Sprache, die Arbeit, ein neues Zuhause? Wie können wir die Menschen, die zu uns gekommen sind, einbinden in die Gestaltung unseres Zusammenlebens? In welcher Weise werden wir uns gegenseitig ändern, formen, inspirieren? Was müssen wir, was die Aufgenommenen leisten? Wie lässt sich Neid auf jene verhindern, die unsere Hilfe derzeit noch brauchen? Und wo liegen die Grenzen der Toleranz? Mit Impulsen von Rupert Neudeck, Rainer Forst, Souleymane Bachir Diagne, Susan Neiman, Robert Pfaller, Lamya Kaddor, Harald Welzer, Claus Leggewie und Fritz Breithaupt.
Die neue Ausgabe: Karl Marx
Für die einen ist Karl Marx Visionär der Freiheit, für die anderen Wegbereiter repressiver Systeme. Wie viel Marx brauchen wir heute? Die neue Sonderausgabe blickt kritisch auf Licht- und Schattenseiten eines Denkers, der keine Utopien bieten wollte, sondern das Werkzeug zur radikalen Kritik der Gegenwart.
Hier geht's zur umfangreichen Heftvorschau!

Was heißt hier Ideologie?
In gegenwärtigen politischen Debatten ist „Ideologie“ ein Kampfbegriff: Ideologen sind verblendet. Der Ideologiekritiker indes wähnt sich über jede Kritik erhaben. Doch gibt es überhaupt einen Standpunkt jenseits der Ideologie? Und was meint dieses Wort eigentlich genau? Eine philosophiegeschichtliche Spurensuche.

Rahel Jaeggi: „Ideologien sind nur praktisch zu überwinden“
Noch immer leben wir im Kapitalismus. Ist Marx’ Geschichtsbild damit widerlegt? Nein, meint die Philosophin Rahel Jaeggi im Gespräch. Denn bereits Marx sah, dass gesellschaftliche Krisen unterschiedliche Ausgänge nehmen können.

Gegen die „Friedenswindbeutel“ – Karl Marx‘ Kritik des bequemen Pazifismus
Seiner generellen Staatskritik zum Trotz plädierte Karl Marx in außenpolitischer Hinsicht dafür, republikanische gegen autoritäre Staaten zu verteidigen, schreibt der Politikwissenschaftler Timm Graßmann in seinem Buch Marx gegen Moskau. Die Haltung der deutschen Linkspartei gegenüber Waffenlieferungen an Kiew hätte der Autor des Kapitals aufs Schärfste kritisiert.
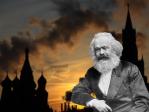
Martin Luther und die Angst
Sein kultureller Einfluss ist nicht zu überschätzen: Martin Luthers Bibelübersetzung bildet den Anfang der deutschen Schriftsprache, seine religiösen Überzeugungen markieren den Beginn einer neuen Lebenshaltung, seine theologischen Traktate legen das Fundament einer neuen Glaubensrichtung. In der Lesart Thea Dorns hat Luther, der heute vor 479 Jahren starb, die Deutschen aber vor allem eines gelehrt: das Fürchten. Oder präziser: die Angst. In ihrem brillanten Psychogramm des großen Reformators geht die Schriftstellerin und Philosophin den Urgründen von Luthers Angst nach – und deren uns bis heute prägenden Auswirkungen.

Eric Klinenberg: „Singles sind keine tragischen Erscheinungen“
Moderne Gesellschaften sind Single-Gesellschaften. Das birgt die Gefahr der Einsamkeit - und die Chance der Freiheit. Anlässlich der Aktionswoche gegen Einsamkeit veröffentlichen wir ein Gespräch mit dem Soziologen Eric Klinenberg über den Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit, den Verdacht gegen Singles und einen Irrtum Peter Sloterdijks.
