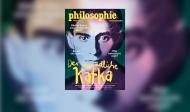Zwischen Kerker und Unendlichkeit – Blanqui zum 220. Geburtstag
Für Louis-Auguste Blanqui stehen Sterne und Revolutionen gleichermaßen für die Verheißung einer besseren Welt. Der kühne Denker und Unruhestifter, zwei Mal zum Tode verurteilt und begnadigt, kam vor 220 Jahren, am 8. Februar 1805, bei Nizza zur Welt. Mit politischen Ideen scheiterte er an seiner Zeit. Der Nachwelt hat er ein anderes Erbe hinterlassen.
Es gibt Figuren, die wie Schatten durch die großen Umwälzungen ihrer Zeit wandern – Blanqui gehört nicht dazu. Er war stets mittendrin. Als Berufsrevolutionär ist sein Leben geprägt von unermüdlicher Rebellion, knapp vier Jahrzehnte verbringt er insgesamt in Haft. Dennoch ist er an nahezu jedem französischen Aufstand beteiligt – von der Julirevolution 1830 über Proteste gegen den Bürgerkönig Louis-Philippe bis zur Revolution von 1848 und der Pariser Kommune 1871. Sein Einsatz dient dem Sozialismus, wenngleich er wie viele Franzosen des 19. Jahrhunderts kein Marxist ist. Marx und Engels gehen davon aus, dass die Revolution in bestimmten Situationen mit Notwendigkeit entsteht. Ihre treibende Kraft steckt im aufbegehrenden Proletariat. Blanqui dagegen schwört auf die Macht des Putsches.
Seine Lehre (Blanquismus) basiert auf der Idee einer Revolution von oben, deren Subjekt nicht die Arbeiterschaft, sondern eine konspirative Gruppe von Geheimbündlern ist. Statt auf Massenbasis setzt er auf Avantgarde und darauf, dem geschichtlichen Gang mit Gewalt nachzuhelfen. Er ist, so könnte man sagen, das Bindeglied zwischen Babeuf und Lenin, zwischen französischer und russischer Revolution, ein unbeugsamer Geist und Fortschrittsdrängler.
Kometen als Kneipenbrüder
Sein Spätwerk, verfasst als Häftling im Fort du Taureau, ist eine schmale und kaum rezipierte Schrift: Die Ewigkeit durch die Gestirne (1871). Dabei ist sie in jeder Hinsicht bemerkenswert. Sie enthält, ungewöhnlich für den Sozialkämpfer, eine Abhandlung über Entstehung und Wesen des Universums, die Bahn von Kometen und eine Spekulation über Doppelgängerwelten, auf denen die Geschichte andere Wendungen nimmt.
Erstaunlich sind bereits die Umstände, unter denen das scheinbar unpolitische Werk entsteht: Blanqui schreibt es im Jahr der Niederlage Frankreichs gegen Preußen und der Pariser Kommune, zu deren Mitglied er in Abwesenheit gewählt wird – seine Anhänger hoffen auf einen Häftlingsaustausch, doch die Regierung von Versailles lehnt ab. Das Buch selbst zeugt von einem Denkstil, der aus Kosmologie, Naturphilosophie und Fantastik gleichermaßen Kapital schlägt.
Fast beneidet man ihn um den vertraulichen Umgang, den er mit dem Universum pflegt. Beim Lesen entsteht der Eindruck, er sei mit kosmischen Kräften per Du. Allerdings spricht er nicht mit dem Zungenschlag eines gelehrten Mystikers, der in Rätselworten galaktische Geheimnisse verkündet. Er bedient sich vielmehr eines vulgärastronomischen Tons – wie jemand, der Kometen zu seinen Kneipenbrüdern zählt und mit der Gravitation abrechnen will: „Bringt die Schwerkraft im Observatoire vor Gericht, angeklagt, Meteorsteine, die man ihr anvertraut hatte, um sie auf ihrer Fahrt ins Blaue auf Kurs zu halten, schelmisch und unrechtmäßigerweise auf die Erde herabstürzen oder fallen zu lassen.“
„Alles, was wir hier hätten sein können, sind wir irgendwo anders“
Der Gedanke, der ihn zur Annahme von Doppelgängerwelten führt, ist so trügerisch wie überzeugend: Das Universum ist unendlich, der atomare Bausatz – bestehend aus Elementen wie Wasserstoff und Helium – dagegen endlich. Alles Existierende muss im Plural existieren, da zwar eine Vielzahl, aber keine endlose Reihe materieller Verbindungen denkbar ist. „Mit einem derart monotonen Plan“, so Blanqui, ist es „nicht einfach, verschiedene Kombinationen zu erzeugen, die genügen, um die Unendlichkeit zu bevölkern. Das Zurückgreifen auf Wiederholungen wird unvermeidbar.“ Das Universum wird unter seiner Hand zum Gewohnheitstier, das auf Bewährtes zurückgreift. Es ist mehr Handwerker als Pionier. Die Existenz von Doppelgängerwelten folgt keinem göttlichen Plan, sondern stellt die Lösung eines logistischen Problems dar.
Jene Welten, die einander gleichen, sind in Relation zu allem anderen zwar selten. Doch es gibt sie, daran lässt sich nicht rütteln. Auf die Unendlichkeit ist Verlass. Unvermittelt taucht in diesen Überlegungen dann der zentrale Satz auf, der den Menschen in den Mittelpunkt stellt: „Alles, was wir hier hätten sein können, sind wir irgendwo anders.“ Blanqui ist überzeugt, dass jeder Einzelne dort oben zigtausend Doubles besitzt, dass jedes private und welthistorische Ereignis sich unzählbar oft wiederholt.
Das Postulat der ewigen Wiederkehr, mit dem Friedrich Nietzsche zehn Jahre später mit einem Paukenschlag die Bühne betritt, ist bereits bei Blanqui anzusetzen. Der Unterschied besteht darin, dass Nietzsche im Anschluss an antike Zeitvorstellungen von einem zyklischen Nacheinander ausgeht, Blanqui von einem Nebeneinander im Raum. Die Idee wird, nach ihrer Doppelgeburt bei Blanqui und Nietzsche, im 20. Jahrhundert in die Schule der Quantenmechanik gehen und als Viele-Welten-Theorie Karriere machen.
Auf zur intergalaktischen Revolution?
Für Blanqui spielt neben der Wiederholung ein weiterer Begriff eine wichtige Rolle: die Variation. Auch als Kosmologe ist er kein Hegelianer oder Marxist, der an ein teleologisches Gesetz der Weltgeschichte glaubt. Er weiß, dass Geschichte – auch und gerade die kosmische Geschichte – von Kontingenz geschrieben wird. „Die Engländer“, so hält er fest, „haben vielleicht viele Male die Schlacht von Waterloo auf jenen Planeten verloren, wo ihr Gegner nicht den Fehler von Grouchy begangen hat.“ Anderswo gewinnt Napoleon dagegen „nicht immer die Schlacht von Marengo, die hier (auf unserer Erde) ein glücklicher Zufall war.“
Die Theorie lässt keinen anderen Schluss zu, als dass es Welten gibt, auf denen die sozialistische Revolution geglückt ist. In der Ferne des Universums sitzt ein anderer Blanqui gerade nicht im Kerker, sondern leitet als Staatsminister die Geschicke des Kommunismus. Einen bitteren Beigeschmack erhält das Gedankenspiel durch die Unmöglichkeit, von Erfolgen und Fehlern seiner Doppelgänger zu lernen. Zu weit sind die Entfernungen, um miteinander in Kontakt zu treten. Irgendein Cäsar, so heißt es exemplarisch, erhält jeden Augenblick aufs Neue „seine 22 Dolchstiche“ im Senat, die ihm als „tägliche Dosis seit dem Nichtbeginn der Welt“ auferlegt sind: „Es ist wahr, dass die Doppelgänger ihn nicht alarmieren. Das ist gerade das Schreckliche! Man kann sich nicht warnen.“
Frei nach dem sowjetischen Prinzip vom „Sozialismus in einem Land“ bleiben die Doppelgängerwelten, ohne Möglichkeit des Austauschs, voneinander unberührt. In anderen Worten: Es gibt keine kosmischen Trotzkisten, die zur intergalaktischen Revolution aufrufen und gemeinsam das Universum befreien. Was also bringt das hypothetische Wissen um diese Welten, wenn ihr Kampf nie auf unsere Erde übergreifen wird? Für Walter Benjamin, der als einer der Ersten auf die Schrift aufmerksam macht, ist die Sache klar. Er sieht die Spekulation ernüchternd als „vorbehaltlose Unterwerfung“ unter die herrschenden Verhältnisse unseres Heimatplaneten an. Die Überlegungen seien „in der Gestalt einer naturalen (Ordnung) das Komplement der gesellschaftlichen Ordnung, die Blanqui an seinem Lebensabend als Sieger über sich erkennen mußte.“
Schicksal ohne Verankerung
Im Passagen-Werk geht Benjamin noch einen Schritt weiter. Dort stellt er das ungefähr zeitgleiche Auftreten der Idee bei Nietzsche, Baudelaire und Blanqui als Reaktion der Ohnmacht gegenüber dem Kapitalismus heraus. Das eherne Gesetz der Wiederholung besagt, dass sich die Dinge unweigerlich ereignen. Die Idee sei nichts als ein „Schlummerkissen“, ein mythisches Sinnbild der Gegenwart, das den aufmarschierenden Kapitalismus als Sieger im Kampf um die Moderne anerkennt. Man kann wie Blanqui die weiße Fahne hissen oder wie Nietzsche für das Unweigerliche Partei ergreifen. In beiden Fällen aber wird die herrschende Ordnung als etwas Unveränderbares begriffen und in Stein gemeißelt.
Aber irrt Benjamin nicht, wenn er das Werk als Kapitulationserklärung liest? Die These der Doppelgängerwelten lässt sich nicht als idealistische Kopfgeburt eines gescheiterten Revolutionärs abtun. Hat es nicht etwas Tröstliches und sogar Ermutigendes, dort oben eine Welt zu wissen, auf der die Geschichte, in welchem Sinn auch immer, geglückt ist? Blanqui lädt dazu ein, die Dinge anders zu sehen. Seine Schrift zeugt nicht von Resignation, sondern von Protest gegen die Tyrannei des Alternativlosen. Wenn unter gleichen Bedingungen eine andere Welt möglich ist – liegt es da nicht an uns, sie zu verwirklichen?
Jede Sekunde, schreibt Blanqui, wird „ihre Weggabelung mit sich bringen“, und er schließt an mit dem ungeheuerlichen Satz: „Das Schicksal findet in der Unendlichkeit keine Verankerung, denn sie (…) hat Platz für alles.“ Das Unvermeidliche existiert nur, solange wir es akzeptieren. Die Sterne mögen unerreichbar sein – ihr Licht aber fällt auf unsere Welt. •
Kilian Thomas ist Redakteur des Philosophie Magazins. Er hat Germanistik und Philosophie in Stuttgart und Leipzig studiert. In seiner Doktorarbeit untersucht er die Darstellung religiöser Transzendenz in literarischen Texten um 1800.
Weitere Artikel
Édouard Louis: „Je inakzeptabler die Gewalt ist, desto mehr müssen wir uns mit ihr beschäftigen“
In seinem Roman Der Absturz zeichnet Édouard Louis die Geschichte seines verstorbenen Bruders nach. Was führte zu seinem Alkoholismus, zu seiner Brutalität und zu seinem frühen Tod? Louis’ Buch versucht, dieses Leben zu verstehen – und reflektiert zugleich das Scheitern bei der Suche nach Gewissheit.

Unter Spannung – Zum 800. Geburtstag des Synthetisierers Thomas von Aquin
Thomas von Aquin gehörte zu den großen Philosophen des Mittelalters. Sein Denken schlug eine Brücke zwischen Vernunft und Glauben, Begründung und Autorität. Vor 800 Jahren wurde Thomas im mittelitalienischen Roccasecca geboren.

Vorbild Kevin Kühnert
Kevin Kühnert hat Twitter verlassen und richtig gehandelt. Die Erzeugung vermeintlicher Wahrheiten durch polemische Überbietung beschädigt die Meinungsbildung von Politikern und Journalisten, meint Svenja Flaßpöhler.

Jens Balzer: „Die 80er sind uns in vielen Dingen sehr nahe“
In den 80er Jahren wurzeln viele Diskurse unserer Gegenwart. Jens Balzer, der dem Jahrzehnt in seinem neuen Buch nachspürt, spricht im Interview über die untergründige Verbindung von Helmut Kohl und Michel Foucault, die Dialektik der Individualisierung und die progressive Kraft der Schwarzwaldklinik.

Utopia on Stage
Was wir an den wirklich großen Popdiven bewundern, ist weit mehr als nur ihr Gesang und Aussehen. Sie sind mythische Gestalten, die letzten Göttinnen in einer säkularen Welt. Vor allem aber stehen sie für ganz eigene Utopien und Gesellschaftsvisionen – und leiten uns so auf dem Weg in eine offene Zukunft. Zur Grammy-Verleihung im Februar 2017 fünf sternenklare Ausdeutungen.
Fäden in die Zukunft legen
Spinnen haben einen schlechten Leumund. Die Retrospektive der Künstlerin Louise Bourgeois könnte das ändern.

Berauscht im Blätterwald
Auf Salami Rose Joe Louis’ neuem Album Akousmatikous wuchern Songs wie Schlingpflanzen.

Die neue Sonderausgabe: Der unendliche Kafka
Auch hundert Jahre nach seinem Tod beschäftigt und berührt Franz Kafka. Fast unendlich erscheint der Interpretationsraum, den sein Werk eröffnet.
Der philosophischen Nachwelt hat Kafka einen Schatz hinterlassen. Von Walter Benjamin und Theodor Adorno über Hannah Arendt und Albert Camus bis hin zu Giorgio Agamben, Gilles Deleuze und Judith Butler ist Kafka eine zentrale Referenz der Philosophie. Überlädt man ihn damit zu Unrecht mit posthumen Deutungen? Vielleicht. Sein Werk lässt sich aber auch als Einladung lesen, seine Rätselwelt zu ergründen und im Denken dort anzuknüpfen, wo er die Tür weit offen gelassen hat.
Hier geht's zur umfangreichen Heftvorschau!