Achille Mbembe: „Ich gehöre nicht zur Denkschule des Postkolonialismus“
Die Erde ist ein Projekt, das die Menschen erst noch verwirklichen müssen, wenn sie nicht das Lebendige und sich selbst zerstören wollen. Dazu müssen wir jedoch unser Denken erweitern und unsere Kategorien erneuern. Ein Gespräch mit dem Philosophen Achille Mbembe über den Wert afrikanischer Mythen für die Bewältigung der ökologischen Krise.
Philosophie Magazin: Herr Mbembe, Sie sind der Meinung, dass unsere Gesellschaften wenig Zeichen für die Zukunft setzen – im Gegensatz zum christlichen Mittelalter mit seinen Kathedralen oder dem alten Ägypten mit seinen Pyramiden. Woran erkennen Sie das?
Achille Mbembe: Als Kollektiv sind wir global zunehmend mit dem „Doppelgänger der Welt“ beschäftigt, unseren Bildschirmen, die noumenale Oberflächen sind. Wir verbringen einen Großteil unseres Tages auf ihnen. Die Datenübertragungs- und Rechengeschwindigkeiten haben sich erhöht, in der digitalen Welt geht alles schnell, doch wir drehen uns im Kreis. Der öffentliche Raum tendiert dazu, sich zu segmentieren. Viele haben festgestellt, dass das Aufmerksamkeitsniveau sinkt, da wir ständig von einer Aktivität zur nächsten wechseln. Aufmerksamkeit ist das, was Kontinuitäten existieren lässt: Aufmerksam zu sein bedeutet, sich in die Lage zu versetzen, das Gestern, das Heute und das, was morgen kommt, miteinander zu verbinden.
Wollen Sie damit sagen, dass die Echtzeit des Internets eine ewige Gegenwart ist, in der wir eingeschlossen sind, außerstande, uns darüber hinauszuprojizieren?
Ja, die Zukunft ist nicht mehr die Quelle, aus der alles andere entspringt. Es gibt keinen Horizont mehr, von dem aus wir uns unsere Gegenwart vorstellen könnten. Es ist, als ob die Geschichte, wie wir sie bis vor Kurzem verstanden, in eine Endphase eingetreten ist und sich zu einer reinen Gegenwart zusammenzieht. Wir sind nur noch in der Lage, diskontinuierliche Augenblicke zu erleben. Die bevorstehende Umweltkatastrophe dient uns als Vorahnung der Zukunft, und es fehlt uns an anderen Bildern und Erzählungen, die wir verkörpern können.
In Ihrem aktuellen Buch schöpfen Sie aus dem afrikanischen Ahnenwissen Ressourcen, um den Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen.
Ja, das ist der Kern meines Buches. Ich weiß, dass mein Projekt etwas Utopisches hat, dass es noch ein weiter Weg ist, bis Afrika vollständig in die offizielle Geschichtsschreibung eingeht und als ein Reservoir betrachtet wird für das, was kommt. Dennoch beschäftigen sich viele der afrikanischen Ahnenmythen mit Nachhaltigkeit und der Bewohnbarkeit der Erde – Fragen, die sich nun dramatisch stellen, da wir befürchten, dass das Abenteuer der Menschheit in der Verbrennung der Welt enden könnte.
Sie greifen unter anderem auf einen Bambara-Mythos über die Entstehung der Erde zurück.
Gemäß der Kosmogonie der Bambara ist die Erde das Produkt einer Verwirbelung in der Mitte des Raums, einer Streckung, ja sogar einer Zerstreuung, die in eine Spirale mündet. Die Spirale dreht sich und der Körper der Erde schwitzt, er sondert eine Materie aus, die so etwas ist wie Schmutz. Dies vermittelt uns ein Bild von der Erde, die keine fertige Substanz, kein Objekt ist, sondern vielmehr Zyklen der Aussaftung und Regeneration unterliegt. Ich habe in diesem Mythos einen Impuls gesucht, der uns von den mehr oder weniger mechanistischen Denkweisen wegführt, die das westliche Verhältnis zum Planeten beherrscht haben.
Sie schlagen vor, den Animismus zu reaktivieren und Berge, Flüsse, Tiere und Pflanzen als „natürliche Personen“ zu betrachten. Um uns in diese Gedankenwelt einzuführen, zitieren Sie wiederholt den Roman Der Palmweintrinker von Amos Tutuola (dt. 1955). Warum ist dieses Werk inspirierend?
Es ist ein wunderbares Buch, angefangen bei seinem Titel. Nicht nur, dass der Rausch eine Enthemmung ermöglicht, sondern der Busch in Afrika wird immer in seinem Gegensatz zum erschlossenen Raum des Dorfes gesehen. Der Held von Tutuola streift also durch den Busch und begegnet Menschen und Nichtmenschen, wohl wissend, dass es bei den Wesen, denen er begegnet, Metamorphosen, Sackgassen und Öffnungen gibt, vielfältige Vermischungen stattfinden und es nicht möglich ist, das Okkulte von der Realität zu unterscheiden. Dies führt zu einer Geisteshaltung, in der die westliche Trennung zwischen der „Welt der Menschen“ und der „Welt der Dinge“ nicht mehr gilt, in der Menschen, Geister, Tiere und Materialien einander durchdringen und jede Person als zutiefst plastisch begriffen wird. Die ökologische Krise schafft eine vergleichbare Situation, da sie uns dazu bringt, uns unserer Porosität in Bezug auf die übrigen Lebewesen und unsere Lebensumwelt bewusst zu werden.
Sie sprechen von der „animistischen Dialektik des Samens, der Aussaat und des Keimens“. Worum handelt es sich dabei und welche Verbindung kann man zur globalen Erwärmung herstellen?
Es handelt sich um ein Denkmuster, das aus der westafrikanischen Sahelzone stammt. Die Sahelzone ist das Afrika der abrupten Jahreszeiten und der klimatischen Risiken. Es gibt eine ganze Geschichte der Dürren, die von einer Generation an die nächste weitergegeben wird. Unter solch drastischen Bedingungen gibt es Jahreszeiten, die sehr kurz sind und sich besser für die Aussaat eignen. Verpasst man eine dieser saisonalen Gelegenheiten, leeren sich die Kornspeicher und man gerät in große Gefahr, muss die Zeit bis zur nächsten Saison überbrücken und Hunger leiden. Der Lebenszyklus und der Zyklus der Jahreszeiten sind also eng miteinander verbunden. Die Frage, was man unter die Erde bringt, das unsichtbare Wachstum von Keimen, steht im Mittelpunkt zahlreicher Erzählungen, die wiederum mit Praktiken verknüpft sind. Es handelt sich um Wissen, das Handlungen steuert. Im Zusammenhang mit der globalen Erwärmung könnten wir von dieser Art von Erfahrungen profitieren.
Sie betonen, dass Afrika andere Dualismen zu bieten hat als der Westen. Welche wären das?
Dieser Teil meiner Arbeit ist eingebettet in einen größeren Diskurskontext. Ich denke dabei an die Überlegungen von Philippe Descola in seinem Buch Jenseits von Natur und Kultur, an das, was Viveiros de Castro über den Perspektivismus der brasilianischen Ureinwohner geschrieben hat, oder auch an die Art und Weise, wie François Jullien über China gedacht hat: Wir sind auf der Suche nach anderen Arten, die Welt zu kategorisieren, als die des Westens. Es geht darum, andere Interaktionen zwischen Menschen und Nichtmenschen in Betracht zu ziehen und ihre gegenseitige Abhängigkeit aufzuwerten.
Was genau meinen Sie?
Die großen Dualismen der westlichen Rationalität sind bekannt, man findet sie zum Beispiel bei Descartes: Es gibt den Gegensatz zwischen Seele und Körper, zwischen Natur und Kultur, zwischen Mensch und Tier. Auch in Afrika gibt es Dualismen – was zeigt, dass der Dualismus im Grunde ein Schema ist, auf das man schwer verzichten zu können scheint. Allerdings neigt man in Afrika eher dazu, das Offene und das Geschlossene, das Sichtbare und das Unsichtbare, das Verletzliche und das Nachhaltige einander gegenüberzustellen. Ich habe den Eindruck, dass sich diese drei strukturierenden Gegensätze für uns Zeitgenossen als anregende Assoziationen eignen. Aufgrund eines immer noch lebendigen Vorurteils stellt man sich Afrika als einen gesonderten Kontinent vor, auf dem die Menschen nicht denken würden. Infolgedessen suchen Intellektuelle und Philosophen nicht spontan in Afrika nach wichtigen Kategorien oder Begriffen. In einer Zeit der globalen Herausforderungen fordere ich dazu auf, die Bibliothek zu erweitern!
Sie betonen, dass wir dazu neigen, einigen unserer Werkzeuge wie Smartphones einen „Androidenstatus“ zu verleihen. Etwas Ähnliches taten die Bambara, die die Stiele von Hacken oder Äxten als Personen betrachteten.
Ja, der Gegensatz zwischen Mensch und Objekt löst sich auf, wenn Sie verstehen, wie formbar, biegsam und elastisch der Mensch ist. Was wir Menschen sind, hängt eng mit den Werkzeugen zusammen, mit denen wir uns umgeben. Wir wachsen und entwickeln uns in einem Umfeld von Artefakten, die uns wiederum formen, unsere Organismen und unsere Handlungsmöglichkeiten gestalten. Wir legen einen Teil unseres Gedächtnisses in unseren Smartphones ab. Wir sprechen mit ihnen, denn sie enthalten Assistenten, sogenannte Voicebots. Wir sprechen über sie auch mit entfernten Personen. Das ist nicht gerade eine Rückkehr zum Animismus in der Bambara-Version, aber es ist ein Wandel, und das hat zwangsläufig Auswirkungen auf die sich entwickelnde Menschheit. Denken Sie an den Menschen, wie ihn die Philosophie der Aufklärung beschreibt, der von lebloser Materie und leblosen Objekten umgeben ist, für den Wissen nur in Büchern enthalten sein kann: Wir erleben gerade die Entstehung einer Menschheit, die mir vollständiger und anständiger erscheint, weil es sich um eine Menschheit handelt, die dabei ist, sich selbst zu entkommen, zu begreifen, dass sie durch die Beziehung zu dem, was sie umgibt, gebildet wird und dass sie nicht stabil ist.
Sie rufen auch ein christliches „Archiv“ auf, um eine Verbindung zwischen Bildschirmen und der Auferstehung, dem Versprechen des ewigen Lebens in einem Körper aus Licht, herzustellen.
Letztendlich scheint mir das, was auf unseren Bildschirmen flimmert, der Mythos eines Sieges über den Tod zu sein. Dem christlichen Mythos zufolge gibt es eine Auferstehung, dann eine Himmelfahrt und eine Verklärung der Körper. Wir haben den Wunsch nach Verklärung beibehalten, wir suchen nach einem Weg, dem der Verwesung geweihten Fleischkörper zu entkommen. Worüber reden die Transhumanisten und die Unternehmer aus dem Silicon Valley derzeit? Von der Möglichkeit, unsere Seelen nicht in das christliche Paradies, sondern in die virtuelle Welt wandern zu lassen, deren Aufbau sie finanzieren.
Sie sehen das Metaverse also als Ersatz für das christliche Paradies?
Das ist es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie lange unsere Transmigration in das Metaverse dauern wird oder ob sie bis zum Ende stattfinden wird, aber das ist das Versprechen, das uns der technolibertäre Diskurs gibt. Und vielleicht gelingt es diesem Diskurs dadurch, ein wenig Zukunft in diese Welt zu bringen, die wir zu Beginn unseres Gesprächs als in sich geschlossen beschrieben haben.
Sie ziehen polemisch eine Parallele zwischen den Technologien zur Geolokalisierung, Nachverfolgung und Bewertung von Menschen und dem transatlantischen Sklavenhandel, bei dem Selektions- und Sortierprinzipien angewandt wurden. Ist es nicht sehr provokant, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit mit Mitteln zur gezielten Vermarktung zu vergleichen?
Ich verstehe sehr gut, dass Sie das provokant finden! Dennoch steckt im Aufkommen der Technologie der Ausdruck einer Logik der Erfassung und Identifizierung von Menschen. Der historische Moment des transatlantischen Handels ist wichtig, weil er aus kapitalistischer Sicht eine Ausweitung des Marktes über seine Grenzen hinaus markiert. Es wurden Preise für etwas gezahlt, das keinen Preis hat: das menschliche Leben. Da die Sklavenhändler den Körper des Negers als Ware, als Äquivalent einer natürlichen Ressource betrachteten, bemühten sie sich, objektive Kriterien für die Bestimmung seines Wertes zu finden. Diese Preise waren zudem unbeständig und eine Gelegenheit für Spekulationen. Für die Zwecke des Sklavenhandels wurden Systeme zur Rückverfolgung von Sklaven, Herkunftsnachweise und Datensammlungen entwickelt.
Und das wiederholt sich jetzt in gewisser Hinsicht?
Wir leben immer noch im Zeitalter des Sortierens und der Selektion. Manche Menschen sind wertvoller als andere, und übrigens wird dieser Wert von den Versicherungsgesellschaften genau festgelegt, man entschädigt nicht die Angehörigen aller Länder auf die gleiche Weise. Das Leben eines Afrikaners ist nach diesen offiziellen Maßstäben weniger wert als das eines Amerikaners. Einige Körper haben biometrische Pässe, mit denen sie die Grenzen überqueren können, andere sind auf unbestimmte Zeit in Flüchtlingslagern, Orten der Rassentrennung, Favelas oder Slums eingesperrt. Damit einige wenige genießen können, müssen Millionen von Körpern verbraucht, Leben verschwendet oder durch harte Arbeit vernichtet werden, insbesondere in den Minen. Das Leben einiger Menschen kann grenzenlos verbraucht werden.
In Ihrem Essay vertreten Sie eine weitere These, die vor allem aufseiten der Linken wenig konsensfähig ist: „An die Stelle der Thematik der Identität muss die des Lebendigen treten.“ Dabei gelten Sie als wichtige Referenz der postkolonialen Studien. Hat die ökologische Dringlichkeit die Frage der Identität verdrängt?
Es sind die Konzepte von Rasse und Identität, die uns blockieren und die Menschheit daran hindern, sich mit sich selbst zu versöhnen, um ihr ökologisches und klimatisches Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Vielfach wurde ich übrigens falsch gelesen: Ich gehöre nicht zur Denkschule des Postkolonialismus. Alles, was ich über Rasse und Rassismus und Identität geschrieben habe, insbesondere in Kritik der schwarzen Vernunft, zielte darauf ab, das Thema zu entwirren, das den wahren Horizont meines Denkens bildet: nämlich das Problem des Gemeinsamen (en-common). Es liegt an uns, die Grenzen der Rasse und der Differenz zu sprengen, um uns die Frage nach dem Ähnlichen, dem Nächsten und dem Gemeinsamen zu stellen. •
Achille Mbembe, geboren in Kamerun, ist Historiker und Philosoph. Er lehrt an der Universität Witwatersrand in Johannesburg, Südafrika. International bekannt wurde er durch sein Buch „Kritik der schwarzen Vernunft“ (2014). Der Essay „La Communauté terrestre“ (Éditions La Découverte, 2023) schließt eine Trilogie ab, die bisher nur teilweise ins Deutsche übersetzt wurde („Politik der Feindschaft“, Suhrkamp, 2017; „Brutalisme“, Éditions la Découverte, 2020)
Weitere Artikel
„Wir brauchen eine Politik des Lebendigen“
Die Corona-Krise bringt auch rassistische Reflexe zum Vorschein. Mal werden „die Chinesen“ stigmatisiert, mal der vermeintlich ansteckende „Andere“. Für den Philosophen Achille Mbembe sollte die Pandemie uns stattdessen dazu anregen, unsere Identität zu hinterfragen.

Die unheimliche Kraft der Mythen
Der Philosoph Ernst Cassirer beschrieb die Funktionsweisen von Mythen darin, dass sie eine affektive Beziehung zur Welt eingehen und eine beinahe magische Anziehungskraft entwickeln können. 100 Jahre später gilt es, die Instrumentalisierung von Mythen zur gezielten Politisierung und die aufklärerische Kraft von Kritik in den Blick zu nehmen.

Und woran zweifelst du?
Wahrscheinlich geht es Ihnen derzeit ähnlich. Fast täglich muss ich mir aufs Neue eingestehen, wie viel Falsches ich die letzten Jahre für wahr und absolut unumstößlich gehalten habe. Und wie zweifelhaft mir deshalb nun alle Annahmen geworden sind, die auf diesem Fundament aufbauten. Niemand, dessen Urteilskraft ich traute, hat den Brexit ernsthaft für möglich gehalten. Niemand die Wahl Donald Trumps. Und hätte mir ein kundiger Freund vor nur zwei Jahren prophezeit, dass im Frühjahr 2017 der Fortbestand der USA als liberaler Rechtsstaat ebenso ernsthaft infrage steht wie die Zukunft der EU, ich hätte ihn als unheilbaren Apokalyptiker belächelt. Auf die Frage, woran ich derzeit am meisten zweifle, vermag ich deshalb nur eine ehrliche Antwort zu geben: Ich zweifle an mir selbst. Nicht zuletzt frage ich mich, ob die wundersam stabile Weltordnung, in der ich als Westeuropäer meine gesamte bisherige Lebenszeit verbringen durfte, sich nicht nur als kurze Traumepisode erweisen könnte, aus der wir nun alle gemeinsam schmerzhaft erwachen müssen. Es sind Zweifel, die mich tief verunsichern. Nur allzu gern wüsste ich sie durch eindeutige Fakten, klärende Methoden oder auch nur glaubhafte Verheißungen zu befrieden.
Gibt es einen guten Tod?
Es ist stockdunkel und absolut still. Ich liege auf dem Rücken, meine gefalteten Hände ruhen auf meinem Bauch. Wie zum Beweis, dass ich noch lebe, bewege ich den kleinen Finger, hebe ein Knie, zwinkere mit den Augen. Und doch werde ich, daran besteht nicht der geringste Zweifel, eines Tages sterben und wahrscheinlich genauso, wie ich jetzt daliege, in einem Sarg ruhen … So oder so ähnlich war das damals, als ich ungefähr zehn Jahre alt war und mir vor dem Einschlafen mit einem Kribbeln in der Magengegend vorzustellen versuchte, tot zu sein. Heute, drei Jahrzehnte später, ist der Gedanke an das Ende für mich weitaus dringlicher. Ich bin 40 Jahre alt, ungefähr die Hälfte meines Lebens ist vorbei. In diesem Jahr starben zwei Menschen aus meinem nahen Umfeld, die kaum älter waren als ich. Wie aber soll ich mit dem Faktum der Endlichkeit umgehen? Wie existieren, wenn alles auf den Tod hinausläuft und wir nicht wissen können, wann er uns ereilt? Ist eine Versöhnung mit dem unausweichlichen Ende überhaupt möglich – und wenn ja, auf welche Weise?

Nikita Dhawan: „Wir tragen das Erbe des Kolonialismus in uns“
Ist der europäische Kolonialismus schon Geschichte? Mitnichten, schreibt die politische Theoretikerin Nikita Dhawan in ihrem neuen Buch. Ein Gespräch über Europas zwiespältiges Erbe, Ignoranz gegenüber unserer Ignoranz und die Grundzüge des Postkolonialismus – Teil vier unserer Reihe über Philosophie des 21. Jahrhunderts.

Männer und Frauen: Wollen wir dasselbe?
Manche Fragen sind nicht dazu da, ausgesprochen zu werden. Sie stehen im Raum, bestimmen die Atmosphäre zwischen zwei Menschen, die nach einer Antwort suchen. Und selbst wenn die Zeichen richtig gedeutet werden, wer sagt, dass beide wirklich und wahrhaftig dasselbe wollen? Wie wäre dieses Selbe zu bestimmen aus der Perspektive verschiedener Geschlechter? So zeigt sich in der gegenwärtigen Debatte um #metoo eindrücklich, wie immens das Maß der Verkennung, der Missdeutungen und Machtgefälle ist – bis hin zu handfester Gewalt. Oder haben wir nur noch nicht begriffen, wie Differenz in ein wechselseitiges Wollen zu verwandeln wäre? Das folgende Dossier zeigt drei Möglichkeiten für ein geglücktes Geschlechterverhältnis auf. I: Regeln. II: Ermächtigen. III: Verstehen. Geben wir Mann und Frau noch eine Chance!
Was nach dem Rückblick kommen könnte
„Posthistoire“, „Postmoderne“, „Postkolonialismus“: Der Philosoph Dieter Thomä verabschiedet die Vorsilbe „Post-“ – und plädiert für Schwellenlust statt Disruption.
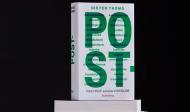
Rettet das Zwitschern
Vielleicht sind Vögel die philosophischsten Tiere überhaupt: weil sie sich nah an unserer Wahrnehmung bewegen und diese auch noch im Flug erweitern. Nicht zuletzt deshalb müssen sie vor dem Aussterben bewahrt werden.
Kommentare
Macht Lust auf mehr.