Anna Tsing: „Bei Plantagen handelt es sich um ein ganzes System der Entfremdung, das bis zu unserem modernen Kapitalismus geführt hat”
Die Anthropologin Anna Tsing feierte mit ihrem Essay Der Pilz am Ende der Welt große Erfolge. Gemeinsam mit Donna Haraway entwickelte sie den Begriff „Plantationozän” und zeigt in ihrem aktuellen Buch die Verwobenheit von Mensch und Natur auf.
Philosophie Magazin +

Testen Sie Philosophie Magazin +
mit einem Digitalabo 4 Wochen kostenlos
oder geben Sie Ihre Abonummer ein
- Zugriff auf alle PhiloMagazin+ Inhalte
- Jederzeit kündbar
- Im Printabo inklusive
Sie sind bereits Abonnent/in?
Hier anmelden
Sie sind registriert und wollen uns testen?
Probeabo
Weitere Artikel
Donna Haraway: „Wir müssen lernen, mit dem Mehr-als-Menschlichen in Kontakt zu treten“
Donna Haraway inspirierte Generationen dazu, neue, kreative Arten der Koexistenz von Mensch, Natur und Technik zu entwerfen. Ihr Denken bewegt sich zwischen Thomas von Aquin, Science-Fiction und Hundetraining. Eine Begegnung unter Bäumen.
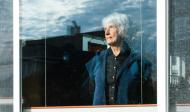
Donna Haraway: „Wir müssen lernen, mit dem Mehr-als-Menschlichen in Kontakt zu treten“
Donna Haraway ist eine der einflussreichsten und innovativsten Philosophinnen unserer Zeit. Ihr feministisch-ökologisches Denken bewegt sich zwischen Thomas von Aquin, Evolutionstheorie, Science-Fiction und Hundetraining. Eine Begegnung unter Bäumen.

„The Last of Us“ – Wie ein mutierter Pilz unsere ethischen Gewissheiten ruiniert
Die Serie The Last of Us führt uns in eine Welt, in der ein Pilz Menschen zu Zombies macht. Dabei stellt der lebende Organismus auch unsere moralischen Gewissheiten infrage. Nicolas Gastineau erklärt, warum.

Fiktion und Wirklichkeit
Für radikale Perspektivwechsel braucht es neue Wörter. Dafür führt Donna Haraway Begriffe ein, die die Welt nicht nur besser erfassen sollen, sondern auch utopische Kraft haben.

Kompost statt Grabstätte
Sterbliche Überreste, die zu Erde werden und im Blumentopf landen? Was ungewöhnlich klingt, ist nun auch im Bundesstaat New York legalisiert worden: „Human Composting“. Warum wir lernen müssen, den Menschen als Humus zu begreifen, weiß die Philosophin Donna Haraway.

Resonanz statt Entfremdung
Ein entfremdetes Weltverhältnis bewirkt, dass wir uns isoliert und abgeschnitten von der Welt fühlen, dass wir diese und uns selbst nicht als lebendige Entitäten erleben. So verstanden ist der Begriff „Entfremdung“ auch heute noch hilfreich für eine kritische Zeitdiagnose. Im Sinne eines gelingenden Weltverhältnisses müssen wir ihm das Prinzip der Resonanz entgegensetzen

Marcus Willaschek: „Wir suchen nach abschließenden Antworten“
Die Kritik der reinen Vernunft revolutionierte die Philosophie. In dem Werk untersucht Kant die Leistungsfähigkeit der Vernunft und zeigt, dass gesichertes Wissen über Gott, die Seele und die Welt als Ganzes nicht möglich ist. Marcus Willaschek im Gespräch über die Grundgedanken dieses epochalen Textes.

Eva Illouz: „Ressentiment ist nicht nur ein Gefühl der Schwachen und Beherrschten“
In ihrem jüngst erschienen Buch Undemokratische Emotionen zeigt die Soziologin Eva Illouz, wie politische Bewegungen sich unsere Gefühle zunutze machen. Im Interview spricht sie über die Muster affektiver Politik und den Aufstieg des populistischen Nationalismus in ihrem Heimatland Israel.
