Cynthia Fleury: „Die Sublimierung des Ressentiments gelingt uns immer weniger“
Das Ressentiment ist eine Selbstvergiftung. Gesellschaftlich nimmt sie dramatisch zu, meint Cynthia Fleury. Was tun? Muss Heilung individuell oder kollektiv ansetzen? Die Philosophin und Psychoanalytikerin über ihr neues Buch Hier liegt Bitterkeit begraben.
Frau Fleury, Sie haben ein Buch über das Ressentiment geschrieben. Welche Gründe haben Sie dazu veranlasst?
Das Ressentiment liegt an den Grenzen zwischen der politischen Philosophie und der Psychoanalyse. Das hat es für mich interessant gemacht. Ich wollte seine Genealogie und seine Mechanismen verstehen. Zugleich wollte ich begreifen, inwiefern ressentimentgeladene Impulse dazu führen, dass Menschen in einem Zustand der Untätigkeit oder Gewalt gefangen bleiben. Zugleich war es ein Versuch, die rechtsstaatliche Demokratie als einen Apparat zur Verdauung von Frustrationen und die öffentlichen Institutionen als Kräfte der Sublimierung zu verstehen. Darüber hinaus erschien es mir auch aus psychoanalytischer Sicht wichtig, den Kampf gegen das Ressentiment als Gegenstand der Therapie hervorzuheben.
Die Demokratie als Verdauungsapparat für Frustrationen? Das müssen Sie uns genauer erklären.
Die rechtsstaatliche Demokratie hilft dabei, Frustrationen abzubauen, da sie das einzige System ist, das um die Fähigkeit zur Kritik herum aufgebaut ist. Gerade deshalb liegt im Zentrum der Demokratie auch immer ein Zustand der Enttäuschung. Man sollte diese Enttäuschung oder demokratische Entzauberung aber nicht unbedingt als etwas Defizitäres lesen. Die Demokratie enttäuscht zwar, aber sie ist die einzige Regierungsform, die dies auch anerkennt und kollektive Mechanismen zur Korrektur dieser Enttäuschung hervorbringt, zum Beispiel durch freie Meinungsäußerung oder kollektive Aushandlungsprozesse.
Sie sind zugleich Philosophin und Psychoanalytikerin. Wie verbinden sich diese beiden Zugänge in ihrer Arbeit?
Seit meinem 2005 erschienenen Buch Les pathologies de la démocratie (Die Pathologien der Demokratie) denke ich über die Verdinglichungsprozesse nach, die in unseren Gesellschaften ablaufen und die letzten Endes dazu führen, dass die rechtsstaatliche Demokratie an Attraktivität verliert. Dies war auch das Thema meines Buches Les Irremplaçables (Die Unersetzlichen) von 2015: Sobald eine Person in dem Gefühl ihrer eigenen Ersetzbarkeit gefangen ist, wendet sie sich von dem Rechtsstaat ab und beginnt, von totaler Anarchie, einem autoritären Staat oder einer Politik des Rückzugs und des Protektionismus zu träumen. Seit der frühen Neuzeit steht die Frage nach der „guten Regierung“ im Zentrum der politischen Philosophie. Diese Frage ist sicher wichtig. Für wichtiger halte ich jedoch die Frage, wie eine demokratische Gesellschaft Ressentiments eindämmen kann und was sie tun kann, um die objektiven Bedingungen abzuschwächen, die Ressentiments entstehen lassen. Damit verschiebt sich der Kern der öffentlichen Politik, denn sie muss alle gesellschaftlichen Bereiche und Instrumente einbeziehen, mit denen sich ressentimentgeladene Impulse korrigieren lassen, zum Beispiel Bildung, Kultur, Medien, Gesundheit, Pflege. Daher verteidige ich den Begriff des Sozialstaats ebenso wie den des Rechtsstaates. Die einzige Möglichkeit für die Demokratie, wieder eine Verbindung zu den Menschen herzustellen, besteht darin, den Rechtsstaat und den Sozialstaat so effizient wie möglich miteinander zu verknüpfen, um soziale Gerechtigkeit herzustellen.
Das Ressentiment ist in der Philosophie sehr unterschiedlich beschrieben worden. Was genau verstehen Sie darunter?
Friedrich Nietzsche und Max Scheler beschreiben das Ressentiment als eine Form der Selbstvergiftung, eine Vergiftung, die zur Besessenheit werden kann. Daran schließe ich an. Ich verstehe das Ressentiment als Phänomen eines tiefen und schmerzhaften Grübelns, das einer Form des Selbstbetrugs ähnelt: Das Individuum konstruiert ein „Delirium“ im klinischen Sinne des Wortes, einen Zustand der Verfolgung und der Viktimisierung. Alles, was es umgibt, wird es herabsetzen und auf ein oder mehrere „schlechte Objekte“ übertragen, also Sündenböcke, wenn Sie so wollen: Migranten zum Beispiel, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger, Staatsdiener – auf jeden Fall eine Figuration des „Anderen“, den man als schuldig und zugleich als besonders geschützt ansieht. Das Ressentiment hängt mit psychischen Gesetzen zusammen. Diese können durch äußere, objektive Bedingungen aber auch verstärkt werden. Wir durchleben gerade eine Zeit, in der dies der Fall ist.
An welche gesellschaftlichen und politischen Veränderungen denken Sie dabei?
In den letzten zwanzig Jahren haben die sogenannten modernen Gesellschaften, vor allem die westlichen, aber auch die lateinamerikanischen, sehr starke Wellen der Neoliberalisierung erlebt, die zu einer starken Deklassierung der Mittelschichten geführt haben. Die Demokratie beruht auf dem sozialen Kompromiss. Ohne eine starke Mittelschicht, die die Spannungen zwischen den Extremen ausgleicht, wird die Demokratie brüchig. Die Mittelschicht sieht sich heute jedoch bedroht von einem Gefühl der wirtschaftlichen und sozialen Deklassierung. Der Rückgang ihrer Kaufkraft, die angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt, die Wohnungskrise, das immer teurere Leben in den Metropolen, der Zwang, in den Vorstädten zu leben – all diese materiellen „Anfechtungen“ sind perfekte Alibis, um ressentimentgeladene Impulse zu kultivieren, da sie vordergründig legitim erscheinen. Wir befinden uns also in einem Moment der möglichen Reaktivierung ressentimentgeladener Impulse. Diese Impulse können beruhigt oder umgekehrt instrumentalisiert werden. Da die Demokratie auf dem Versprechen der Gleichheit beruht, ist sie besonders anfällig für Ressentiments. Autoritäre oder diktatorische Systeme, die von vornherein nicht auf Gleichheit abzielen, sind weniger anfällig dafür.
Ci-gît l’amer lautet der Titel Ihres Buches im französischen Original. Darin ist ein Wortspiel enthalten, das die deutsche Übersetzung leider nicht einfängt. Denn „l’amer“ (das Bittere, die Bitterkeit) klingt im gesprochenen Französisch genauso wie „la mère“ (die Mutter) und „la mer“ (die See, das Meer). Diese Figuren – die Bitterkeit, die Mutter und das Meer – spielen in Ihrem Nachdenken über das Ressentiment alle drei eine wichtige Rolle. Wofür stehen sie jeweils?
Schematisch und stilistisch gesehen, stehen diese drei Figuren für die Phasen des Prozesses der Sublimierung und der Individuation. Unter Sublimierung versteht Sigmund Freud die Fähigkeit, die Erfüllung des Lustprinzips aufzuschieben. Mit anderen Worten, es geht darum, eine Frustration zu akzeptieren und zu überwinden, indem man die Lustbefriedigung auf ein anderes Niveau verlagert. Individuation wiederum ist ein anderer Name für Subjektivierung, das heißt es geht um den Prozess, durch den ein Individuum sich selbst konstruiert und zum Subjekt im eigentlichen Sinne wird, also zum Autor und Urheber seines eigenen Lebens.
Aber wie kommt nun das Ressentiment ins Spiel?
Die Phasen dieses zweifachen Prozesses – Sublimierung und Individuation – sind zugleich Phasen der Begegnung mit der Realität: das Bittere (l’amer), das ist die Ungerechtigkeit, die Ungewissheit und das Nicht-Synthetisierbare, also das, was sich nicht zusammenfügen lässt; die Mutter (la mère), das ist die Unausweichlichkeit der Trennung und die Erfahrung der Trauer; das Meer (la mer) schließlich steht für das, was man mit Rainer Maria Rilke das „Offene“ nennen könnte. Das Offene hat bei Rilke mit dem Realen, dem Nicht-Synthetisierbaren, der Destabilisierung, aber auch mit der Ruhe zu tun. Das Offene zu wählen ist gleichbedeutend damit, das Prinzip der Individuation zu wählen und dem Ressentiment zu widerstehen. Das Meer öffnet die Vorstellungskraft, die es wiederum ermöglicht, die heutige soziale Realität nicht für die einzige mögliche zu halten. Das Reale ist vielmehr das, was erfunden wird.
Wie ist das zu verstehen?
Denken Sie zum Beispiel an das Frauenwahlrecht. In Bezug auf die soziale Realität wurde es lange Zeit für Unsinn gehalten. Das änderte sich nach seiner Einführung. Vielleicht wird es mit dem Grundeinkommen für alle irgendwann einmal ähnlich sein. Die Vorstellungskraft derealisiert nicht, sie baut die Zukunft auf! Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in erster Linie sprachliche Wesen sind. Durch den Logos sind wir in der Welt. Durch das Wort produzieren wir das Reale.
Da Sie das Frauenrecht erwähnen: Ist das Ressentiment, psychoanalytisch gesehen, bei Männern und Frauen verschieden ausgeprägt?
Max Scheler zufolge sind Frauen der Gefahr des Ressentiments stärker ausgesetzt als Männer. Dieser Umstand ist nicht essentialistisch zu verstehen. Er spiegelt vielmehr die patriarchale Struktur wider, in die Frauen eingebunden oder in der sie gefangen sind. Pathologien sind in Epochen und historische Zusammenhänge eingebettet, auch wenn manche von ihnen auf persönlichen Faktoren beruhen. Nehmen wir zum Beispiel die Hysterie. Diese wurde lange Zeit feminisiert, obwohl sie vor allem eine bestimmte Konditionierung widerspiegelt, die der Frau auferlegt wurde: die Reduzierung ihrer Welt, die Beschränkung auf das Private und Kleine, der Hausarrest, das Verbot der Selbsterweiterung. Im klinischen Bereich sind die Hysterien heute, wenn sie in den demokratischen Gesellschaften auftreten, ebenso männlich wie weiblich, da sie – leider – auf ein zunehmend geteiltes Schicksal in der Unterwerfung verweisen. Man hätte sich gewünscht, dass die Unterwerfung in den sogenannten modernen Gesellschaften an Boden verliert, was sie in mancher Hinsicht auch getan hat, doch hat sie dabei ihren Wirkungskreis vergrößert und die Männer konsequenter einbezogen.
In Ihrem Buch schreiben Sie, dass das Ziel der Psychoanalyse ebenso therapeutisch wie politisch ist. Das erscheint erklärungsbedürftig. Schließt die Analyse dadurch, dass sie sich auf das individuelle Subjekt fokussiert, das Politische nicht zwangsläufig aus?
Erlauben Sie mir, auf diese Frage autobiographisch zu antworten. Ich selbst habe eine Analyse begonnen, als ich noch ein Teenager war. Damals spürte ich noch keinerlei Berufung, selbst Analytikerin zu werden. In der Behandlung ging es um das, was ich den „Familienroman“ nenne, das heißt ein besseres Verständnis der Eltern, der Trauerfälle, des Intimen. Als ich später eine akademische Laufbahn in der Philosophie einschlug, waren diese beiden Wege – der persönliche, therapeutische Weg auf der einen Seite und der akademische, philosophische auf der anderen – noch voneinander getrennt. Dann änderten sich die Dinge, denn meine Laufbahn als Lehrerin und Forscherin brachte mich mit einer neuen Art von Gesprächspartnern zusammen, deren Leiden vor allem mit dem Arbeitsplatz zu tun hatte. Ich bin dann relativ spät Analytikerin geworden, um mir die Besonderheit dieses Leidens, das eminent politisch ist, anzuhören.
Worin ging es in diesen Gesprächen?
Was diese Patienten zur Sprache brachten, hatte wenig mit ihrem persönlichen „Familienroman“ zu tun. Vielmehr ging es um allgemeine gesellschaftliche Zusammenhänge, die Funktionsstörungen der Demokratie und der Wirtschaft, die Entmenschlichung der Arbeitswelt. Im Mittelpunkt stand der Kollege, der Chef, das unerreichbare Ziel, der unnötige Druck, die Unsicherheit, die narzisstischen Kränkungen, und, wenn man sich davon entfernte, die Absurdität der Welt, der Müll, die Atomkraft, der Terrorismus. Es gibt ein Kontinuum zwischen der politischen Philosophie und der Psychoanalyse, da das Wort des Subjekts sowohl in der rechtsstaatlichen Demokratie als auch in der analytischen Sitzung eine konstitutive Bedeutung besitzt. Beides muss in Einklang gebracht werden. Es ist wichtig, dass das Individuum oder der Patient sowohl seine Familienneurose – den sogenannten „Familienroman“ – als auch die gesellschaftlich bedingten Neurosen – den sogenannten „Gesellschaftsroman“ – erzählt. Das heutige Unwohlsein ist direkt mit dem Unwohlsein der Welt verbunden. Es gibt eine Rückkehr eminent politischer Ängste. Beispielsweise haben die Menschen wieder Angst davor, in ihrem Leben eine Kriegserfahrung zu machen.
Sie betonen vor allem die Gefahren, die das Ressentiment für die politische Ordnung darstellt. Aber haben viele Menschen nicht gute Gründe, über die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse unzufrieden und verbittert zu sein?
Was hält ein Subjekt aufrecht und was hält eine Gesellschaft aufrecht? Ganz sicher nicht die Gewalt oder das Ressentiment, sondern die Sublimierung davon! Man leugnet die Gewalt nicht, sondern setzt sie außer Kraft, sowohl durch die individuelle Symbolisierung als auch durch die kollektiven Sublimierungskräfte, wie sie etwa Bildung und Kultur darstellen. Es scheint, dass uns dies heute immer weniger gelingt. Übernimmt erstmal die Gewalt die Führung, kann alles passieren: Bürgerkrieg im Inneren, Krieg nach außen, aber gewiss nicht Politik im demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen Sinn. Ich weiß, dass viele am liebsten glauben würden, dass sich die Ungerechtigkeit politisch in das Ressentiment übersetzt, aber das ist leider völlig falsch. Sie können die schlimmste Ungerechtigkeit und das schlimmste Leid erleben, ohne Ressentiments zu entwickeln. Oder sie können umgekehrt Ressentiments entwickeln, ohne jemals ein Trauma erlebt zu haben. Es geht mir nicht darum zu leugnen, dass es unerträgliche Ungerechtigkeiten gibt, die man politisch mit aller Kraft bekämpfen muss. Wenn die Frage jedoch lautet, ob Ressentiments ein guter Motor für historischen Fortschritt sind, dann lautet die Antwort ganz klar: Nein.
Aus der Perspektive sozial benachteiligter Personen, die auf die Straße gehen, um gegen bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen zu protestieren, könnte Ihr Ansatz leicht überheblich wirken. Vielleicht würden Sie Ihnen entgegnen: Wir brauchen keine Therapie und müssen auch nicht geheilt werden, weil wir nicht das Problem sind.
Gewiss ist es notwendig, kollektive Strategien und soziale Bewegungen hervorzubringen, um mehr soziale Gerechtigkeit hervorzubringen. Dies ist sogar eine der grundlegenden Anforderungen der Demokratie. Allerdings gibt es auch psychische Gesetze und kollektive emotionale Phänomene, die, wenn sie nicht verstanden und reguliert werden, die wesentliche Fähigkeit der Demokratie untergraben können, die darin besteht, Konflikte zwischen Gruppen auf effiziente und gerechte Weise zu organisieren. Die Demokratie ist eine Arena der Komplexität. Ressentiments und nicht sublimierte Impulse führen zu einem sektiererischen, gefährlichen Denken in Schwarz und Weiß.
Aber gibt es neben der toxischen Form des Ressentiments, die Sie beschreiben, nicht auch eine berechtigte Form der Bitterkeit, die zu einem Antrieb für emanzipatorische Bewegungen werden kann? Anders gesagt, besitzt das Ressentiment in ihren Augen überhaupt kein positives Potenzial?
Nein, das Ressentiment hat keine positive Kraft, absolut keine. Das Ressentiment und die Erfahrung der Bitterkeit müssen eindeutig voneinander unterschieden werden. Nicht jedes Leid, nicht jede Not erzeugt Missgunst und Ressentiments. Das Leben ist eine Abfolge von bitteren Erfahrungen. Bitterkeit ist untrennbar mit dem Wissen um die menschliche Endlichkeit verbunden. Das Bittere ist ein äußerst subtiler Geschmack; er wird erst mit der Erfahrung erworben. Und erst mit der Erfahrung lernt man vielleicht auch, ihn zu genießen.
Kann es eine Heilung vom Ressentiment auf kollektiver Ebene geben? Wenn ja, wie genau? Oder muss man vielmehr, so wie es die Psychoanalyse tut, beim Individuum ansetzen?
In der Politik gilt ebenso wie in der Psychoanalyse: Alles, was dem Subjekt ermöglicht, Handlungsmacht zu erlangen, zu tun, zu schaffen, die Dinge nicht so zu erleiden, dass es in der Viktimisierung gefangen bleibt, mit anderen Worten alles, was ihm einen befähigenden Umgang mit der Verletzlichkeit ermöglicht, eröffnet zugleich die Möglichkeit, dem Ressentiment zu entfliehen. Hierzu bedarf es nicht spezifisch psychoanalytischer Arbeit, sondern analytischer Arbeit im Allgemeinen – das heißt die Möglichkeit für das Subjekt, kritisch auf sein Leben zurückzuschauen und intellektuell und praktisch Strategien zu entwickeln, um seine Handlungsfähigkeit wiederzuerlangen.
Cynthia Fleury: „Hier liegt Bitterkeit begraben. Über Ressentiments und ihre Heilung“, übers. v. Andrea Hemminger, Berlin: Suhrkamp 2023
Weitere Artikel
Das Unantastbare retten
In ihrem Essay Klinik der Würde untersucht die Philosophin und Psychoanalytikerin Cynthia Fleury, warum das Leben vielerorts immer unwürdiger wird, während man Würde deutlicher einklagt als je zuvor.
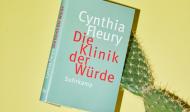
Sue Grand: „Als Analytikerin kümmere ich mich um die kulturellen und historischen Wunden meines Patienten“
Kollektive historische Traumata hinterlassen meist gravierende Spuren, die auch nachfolgende Generationen noch zeichnen. Wie werden solche Traumata von Eltern an ihre Kinder weitergegeben? Ein Gespräch mit der Psychoanalytikerin Sue Grand über kollektive Wunden, gegenseitige Sorge und soziale Gerechtigkeit.

Eva Illouz: „Ressentiment ist nicht nur ein Gefühl der Schwachen und Beherrschten“
In ihrem jüngst erschienen Buch Undemokratische Emotionen zeigt die Soziologin Eva Illouz, wie politische Bewegungen sich unsere Gefühle zunutze machen. Im Interview spricht sie über die Muster affektiver Politik und den Aufstieg des populistischen Nationalismus in ihrem Heimatland Israel.

Freund oder Feind?
Globale Migrationsströme, religiöse Ressentiments, kriegerische Konflikte – die Figur des Anderen hat politische Hochkonjunktur. Lässt sich kulturelle Andersheit im Dialog aufheben, oder gibt es vernünftige Differenzen, die keiner Vermittlung zugänglich sind?
Der Wertejongleur – Max Scheler zum 150. Geburtstag
Max Schelers Ansichten zum Krieg wandelten sich vom Befürworter zum Pazifisten. Gerade im Hinblick auf heutige Debatten macht ihn seine Offenheit für unterschiedliche Perspektiven zu einem wichtigen Denker des Ressentiments. Gestern jährte sich der Geburtstag des Philosophen zum 150. Mal.

Karel Kosík – Gegen Nazis, Stalinisten und Marktgläubige
Karel Kosík war einer der bedeutendsten tschechischen Denker des vergangenen Jahrhunderts. Aufgrund seiner Kritik am kommunistischen Staat wurde er zu einer Persona non grata und sein Werk vergessen. Doch besonders sein Konzept des „Pseudo-Konkreten“ kann helfen, Antworten auf heutige Ressentiments zu finden.

Jacques Rancière: „Es gibt keine Krise der Demokratie, weil es keine wirkliche Demokratie gibt“.
In Frankreich haben Rechtsextreme die Europawahlen gewonnen und könnten auch bei den Parlamentswahlen am 30. Juni und 7. Juli triumphieren. Der französische Philosoph Jacques Rancières schätzt die Lage als dramatisch ein. Ein Gespräch über die Diskurshoheit der Rechtsextremen, Pathologien der V. Republik und die Wahl zwischen Ressentiment und Resignation.

Christoph Möllers: „Zu sagen: ‚Das tut mir weh!’ reicht nie“
Liberalismus wird oft gleichgesetzt mit einer Verteidigung individueller Freiheit gegen staatliche Gewalt. In seinem soeben erschienenen Buch Freiheitsgrade macht sich Christoph Möllers, Professor für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin, für ein anderes Verständnis des Liberalismus stark, das den Staat weniger als Bedrohung, denn vielmehr als Schutz begreift. Wie weit aber darf dieser Schutz reichen? Ein Gespräch über Freiheit in Zeiten von Corona, gesellschaftliche Verletzbarkeiten und Freiheitsräume, die produktiv irritieren.
