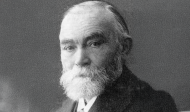Alexander Grothendieck, ein außergewöhnlicher Mathematiker
Zum internationalen Welttag der Mathematik stellen wir Ihnen den genialen Mathematiker, radikalen Umweltschützer und vehementen Antimilitaristen Alexander Grothendieck vor, dessen Arbeiten den Blick des Faches auf sich selbst grundlegend verändert haben.
1928: Eine Kindheit im Zeichen des Anarchismus
Alexander Grothendieck wurde 1928 in Berlin in eine jüdische Familie geboren. Seine ukrainischer Vater und seine deutsche Mutter verkehrten in anarchistischen Kreisen. Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme flohen sie 1933 zunächst nach Frankreich. Kurze Zeit später zogen sie weiter nach Spanien und unterstützten dort die anarchosyndikalistische Bewegung in der sozialen Revolution. Alexander blieb zunächst in Deutschland, wurde einem protestantischen Pastor in der Nähe von Hamburg anvertraut und später in einem Kinderheim der Schweizer Kinderhilfe versteckt. So heißt es in seiner Autobiografie mit dem Titel Récoltes et Semailles (Ernte und Aussaat) (Gallimard, 2022): „Die meisten von uns waren Juden, und wenn wir (von der örtlichen Polizei) gewarnt wurden, dass es Razzien der Gestapo geben würde, versteckten wir uns für eine Nacht oder zwei in kleinen Gruppen von zwei oder drei in den Wäldern, ohne uns wirklich bewusst zu sein, dass es um unsere Haut ging. Die Gegend war voll von Juden, die sich im Land der Cevennen versteckt hatten, und viele überlebten dank der Solidarität der örtlichen Bevölkerung.“ Im Mai 1939 fand er seine Eltern wieder. Sein Vater aber, der als gefährlicher Agitator galt und sowohl vom zaristischen Russland als auch von der Roten Armee mehrfach zum Tode verurteilt worden war, wurde bald in ein Konzentrationslager verschleppt. Er starb 1942 in Auschwitz. Seine Mutter und er überlebten und zogen nach dem Krieg nach Montpellier. Aufgrund seines verworrenen Lebenswegs blieb Alexander lange Zeit staatenlos.
1949: Einführung in die Mathematik und erster Durchbruch
Grothendieck schrieb sich an der Universität Montpellier ein. Er erhielt ein Empfehlungsschreiben für die École normale Supérieure. Mit gerade einmal einundzwanzig Jahren war der junge Mann auf dem Gebiet der Mathematik praktisch Autodidakt: „Ich verbrachte einen Großteil meiner Zeit, sogar während der Unterrichtsstunden, damit, Matheaufgaben zu lösen. Bald genügten mir die im Buch enthaltenen nicht mehr. Vielleicht, weil sie mit der Zeit zu sehr dazu neigten, einander zu sehr zu ähneln; vor allem aber, glaube ich, weil sie zu sehr vom Himmel fielen, einfach so, in einer Reihe, ohne zu sagen, woher sie kamen oder wohin sie gingen. Das waren die Probleme des Buches, nicht meine Probleme“. Seine Lehrer Laurent Schwartz und Jean Dieudonné legten ihm eine Liste mit vierzehn Problemen vor, die allesamt höchst schwierig sind. Grothendieck gelingt es innerhalb weniger Monate alle zu lösen.
1966: Von der Neuerfindung der Geometrie zur Fields-Medaille.
Philosophie Magazin +

Testen Sie Philosophie Magazin +
mit einem Digitalabo 4 Wochen kostenlos
oder geben Sie Ihre Abonummer ein
- Zugriff auf alle PhiloMagazin+ Inhalte
- Jederzeit kündbar
- Im Printabo inklusive
Sie sind bereits Abonnent/in?
Hier anmelden
Sie sind registriert und wollen uns testen?
Probeabo
Weitere Artikel
George Marshall: "Der Klimawandel ist ein Problem der Gegenwart, nicht der Zukunft"
Warum stellen wir uns angesichts der drohenden Klimakatastrophe blind und taub? Antworten des radikalen Umweltschützers George Marshall am Vorabend der Pariser Klimakonferenz
Werden Roboter uns ersetzen?
Im Jahr 1950 entwarf der Mathematiker Alan Turing den sogenannten Turing-Test, der prüft, inwiefern es einem Computer gelingt, bei einem simulierten Gespräch als menschliches Gegenüber durchzugehen.
Moreno Andreatta: „Alles beginnt mit einer Intuition“
Wie findet man mathematische Lösungswege? Wie gelingt eine Komposition? Moreno Andreatta ist Mathematiker und Musiker. Im Gespräch erklärt der renommierte Forscher, wie sich beide Bereiche gegenseitig befruchten und warum ohne Intuition nichts Neues in die Welt käme.

Die Größte ihrer Zeit
Die Mathematikerin und Philosophin Hypatia zählte zu den einflussreichsten Denkerinnen des spätantiken Alexandrias, bis sie von einem fanatisierten christlichen Mob ermordet wurde. Der Nachwelt ist sie als Märtyrerin der Philosophie im Gedächtnis geblieben.

Bertrand Russell und die Mathematik
Philosophen formulieren oft provokant und scheinbar unverständlich. Doch gerade die rätselhaften Sätze sind der Schlüssel zum Gesamtwerk. Auch Bertrand Russels Auffassung von Mathematik ist nicht, was sie zunächst scheint.

Alexander Oberleitner: „Momo ist als systemgefährdendes Buch geschrieben worden“
Michael Ende ist Millionen Menschen als Jugendbuchautor bekannt. In seiner Monographie Michael Endes Philosophie im Spiegel von Momo und Die unendliche Geschichte geht Alexander Oberleitner allerdings den philosophischen Dimensionen von Endes Werk nach und erläutert, warum dessen Einfluss nicht an der Kinderzimmertür endet.

„Oppenheimer“, die Bombe und die Philosophen
Insgesamt sieben Oscars gewann Christopher Nolans Film Oppenheimer über den „Vaters der Atombombe“ bei der heutigen Verleihung. Von Albert Camus über Hannah Arendt bis Hans Jonas äußerten sich Denker immer wieder zu der Waffe, die unseren Blick auf Technik und Krieg grundlegend verändert hat.

Gottlob Frege und die Sprache
Gottlob Frege, dessen Todestag sich am 28. Juli 2025 zum 100. Mal jährte, gilt als Wegbereiter der analytischen Philosophie: jener Strömung, die sich von metaphysischer Spekulation abwandte und nach einer präzisen, an die Mathematik erinnernden Sprache suchte. Was hat uns Frege über Funktionsweise und Fallstricke der Sprache zu sagen?