Rousseau und der volonté générale
Einzelinteressen lassen sich mit dem Gemeinwesen in Einklang bringen, indem man vom Gesamtwillen das Mehr oder Weniger abzieht, meint Jean-Jacques Rousseau. Sie verstehen nur Bahnhof? Wir helfen weiter.
Das Zitat
„Es gibt oft einen beträchtlichen Unterschied zwischen dem Gesamtwillen (volonté de tous) und dem Gemeinwillen (volonté générale); dieser sieht nur auf das Gemeininteresse, jener auf das Privatinteresse und ist nichts anderes als eine Summe von Sonderwillen: aber nimm von ebendiesen das Mehr oder Weniger weg, das sich gegenseitig aufhebt, so bleibt als Summe der Unterschiede der Gemeinwille.“
Vom Gesellschaftsvertrag (1762)
Die Relevanz
Wie lässt sich Herrschaft legitimieren? Als erster moderner Denker antwortet Rousseau hierauf, dass die Macht beim Volk selbst liegen müsse. Ihm schwebt allerdings keine repräsentative Demokratie mit konkurrierenden Parteien vor. Vielmehr solle der „Gemeinwille“, mit dem sich alle Bürger identifizieren, leitend sein. Die Idee erfuhr unterschiedlichste Ausdeutungen: Die Jakobiner verstanden sie zur Zeit der Französischen Revolution als Rechtfertigung ihrer Terrorherrschaft, die 68er hingegen als Anleitung zur Basisdemokratie. In unserer gegenwärtig stark polarisierten Gesellschaft verweist der „Gemeinwille“ vor allem auf eine drängende Frage: Kann politischer Zusammenhalt bestehen, wenn Individuen und Gruppen jeweils nur ihre eigenen Interessen verfolgen?
Die Erklärung
Rousseau unterscheidet den „Gemeinwillen“ vom „Gesamtwillen“. Letzteren hält er für problematisch, weil er lediglich von „Privatinteressen“ motivierte „Sonderwillen“ summiert. Auf diese Weise könnten sich Mehrheiten für Entscheidungen ergeben, die das „Gemeininteresse“ gefährden. Beispielsweise wäre es wohl im Privatinteresse vieler, keine Steuern zu zahlen. Würde man nun deshalb alle Steuern abschaffen, wären die Folgen für die Allgemeinheit desaströs. Rousseau fordert, dass jeder Bürger sich als Teil des Ganzen begreift und sich fragt, was er für das Zusammenleben aller will. Wenn so das jeweils Partikulare von den Sonderwillen abgezogen wird, ergibt sich ein einstimmiger und vernünftiger „Gemeinwille“ – zumindest in der Theorie. •
Weitere Artikel
Leben und Werk im Widerspruch: Jean-Jacques Rousseau
In dieser Reihe beleuchten wir Widersprüche im Werk und Leben großer Denker. Heute: Jean-Jacques Rousseau, der trotz seiner radikalen Erziehungsideale seine eigenen Kinder ins Waisenhaus gab.
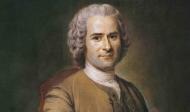
Wann bin ich ganz ich?
Man selbst sein – eine große Sehnsucht in einer Welt der Entfremdung. Doch wann und wie ist das zu schaffen? Jean-Jacques Rousseau, Jean-Paul Sartre und Judith Butler haben da drei Tipps für Sie.

Jacques Derrida und die Sprache
Die Sprache – auch die gesprochene – ist ihrer Struktur nach Schrift, so die These Jacques Derridas. Klingt unlogisch? Wir helfen weiter.

Rousseau gegen Tomaten im Winter
Durch steigende Energiekosten wird der Anbau von Tomaten in beheizten Gewächshäusern für viele Landwirte unrentabel. Schweden kündigte nun sogar an, die nationale Produktion einzustellen. Also keinen Tomaten in diesem Winter? Für Rousseau ist das kein Problem.

Zukunftsträume eines Geistersehers
Ende des 19. Jahrhunderts wollte der Philosoph Carl du Prel den Spiritismus mit dem Geist der modernen Wissenschaft in Einklang bringen. Noch heute sind Medientheoretiker beflügelt von du Prel – höchste Zeit, den Spiritisten und sein Denken genauer zu betrachten.

Herbert Marcuse (1898–1979)
Unbeugsamer kritischer Denker, Idol der Studierendenproteste von 1968: Herbert Marcuse schaffte es wie kein anderer seiner Kollegen, sein kritisches Denken mit politischem Aktivismus in Einklang zu bringen. Seine Werke faszinieren durch ihren utopischen Gehalt und durch ihr Drängen auf die Befreiung der Gesellschaft von den Zwängen des Kapitalismus

Jacques Rancière: „Es gibt keine Krise der Demokratie, weil es keine wirkliche Demokratie gibt“.
In Frankreich haben Rechtsextreme die Europawahlen gewonnen und könnten auch bei den Parlamentswahlen am 30. Juni und 7. Juli triumphieren. Der französische Philosoph Jacques Rancières schätzt die Lage als dramatisch ein. Ein Gespräch über die Diskurshoheit der Rechtsextremen, Pathologien der V. Republik und die Wahl zwischen Ressentiment und Resignation.

Jean-Vincent Holeindre: „Für Europa steht seine eigene Existenz auf dem Spiel“
Der Philosoph, Professor für Politikwissenschaft und Spezialist für Militärstrategie Jean-Vincent Holeindre erläutert im Interview, warum Putins Invasion der Ukraine als Angriff auf die Idee der liberalen Demokratie insgesamt zu verstehen ist.
