Weniger wählen gehen, mehr Lotto spielen
Die Reform des deutschen Wahlrechts gleicht einer Sisyphosaufgabe. Dabei liegt die Lösung auf der Hand: das Losverfahren. Höchste Zeit, dem urdemokratischen Prinzip mehr Aufmerksamkeit zu schenken, findet Hendrik Buchholz.
Einen überparteilichen Konsens im Deutschen Bundestag zu finden, scheint naturgemäß schwer zu sein. So verwundert es nicht, dass die Diskussion um ein neues Wahlrecht schon jahrelang einen Zankapfel im politischen Berlin darstellt. Jüngst haben drei Abgeordnete der Ampelkoalition einen realisierbaren Vorschlag unterbreitet. Die Zweitstimme, mit der die relative Verteilung der Sitze entschieden wird, soll gestärkt werden; notfalls Direktmandate sogar wegfallen. Dass Direktmandate aber tatsächlich ihre Relevanz verlieren, kann bei der CDU/CSU-Fraktion jedoch nur auf Ablehnung stoßen, die von so vielen Direktmandaten profitiert wie keine andere Fraktion im Hohen Haus.
Wie lassen sich endgültig die Ängste vor einem sprichwörtlichen Platzen des Bundestags nehmen? Was bringt die Stimmen, die von Effizienzlosigkeit und Vertrauensverlust sprechen, endlich zum Verstummen? Anders gefragt: Wie sollte Deutschland wählen? Auf diese komplexe Frage gibt es zum Glück eine einfache Antwort: Gar nicht. Vielleicht ist die Wahl nicht das angebrachte Verfahren, um Repräsentanten in einer Demokratie auszuwählen. Vielleicht müssen wir die Wahl an sich in Frage stellen und Alternativen ausloten. Und welches Verfahren könnte eine mindestens angemessene Alternative bieten? Naja – das demokratische Verfahren schlechthin: das Los.
Rückhalt aus der Antike
Das Losverfahren hat einen schweren Stand. Das schöne deutsche Wort „Schnapsidee“ ist dabei die häufigste Rückmeldung auf diesen Vorschlag, auch von politisch Interessierten. Die Kritik erfolgt häufig in Verbindung mit dem Vorwurf, naiv zu sein; wie man denn denken könne, jeder zufällig ausgewählte Bürger könnte sich produktiv mit den politischen Problemen unserer Zeit beschäftigen. Diese Kritik erinnert ein wenig an das vollkommen unterkomplexe Urteil über die kommunistische Idee: Schön in der Theorie, Genosse, aber in der Realität nicht machbar! Aber es findet sich Rückhalt in der Ideengeschichte. Bei Aristoteles findet sich z.B. folgende Stelle: „Es gilt z.B. für demokratisch, die Staatsämter durchs Los, und für oligarchisch, sie durch Wahl zu besetzen.“ Wer nun denkt, hier handle es sich um eine Einzelmeinung: weit gefehlt! Die Vorstellung eines aristokratischen Wahlverfahrens auf der einen und eines demokratischen Losverfahrens auf der anderen Seite durchzieht die gesamte politische Ideengeschichte, sie scheint jedoch in völlige Vergessenheit geraten zu sein.
Werfen wir einen Blick auf die Wiege der Demokratie: das antike Griechenland. Der Stadtstaat Athen kann uns als demokratisches Vorzeigebeispiel dienen, über seine politischen Prozesse wissen wir einfach am meisten im Vergleich zu den anderen zahlreichen Poleis, die sich vor mehr als 2.500 Jahren, platonisch ausgedrückt, wie Frösche um den großen Teich des Mittelmeers angesiedelt hatten. Der erste Einwand sei gleich abgewendet: Natürlich waren Frauen und Sklaven ausgeschlossen aus den politischen Entscheidungsprozessen der damaligen Zeit. Aber trotzdem: Auch wenn man davon ausgeht, dass nur eine Minderheit der Bewohner politische Teilhaberechte genoss, zeigte sich im antiken Athen eine bemerkenswert inklusive Möglichkeit für außergewöhnlich viele Personen unterschiedlichen Standes, sich einzubringen. Ganz nebenbei sei Bescheidenheit angemahnt, denn wer weiß schon um die Kommentatoren der Zukunft, die womöglich das fehlende Wahlrecht von in Deutschland dauerhaft lebenden Migranten ohne Staatsbürgerschaft gerechtfertigterweise kritisieren werden.
Geburtsfehler der modernen Demokratie
Das demokratische Erbe des antiken Athens liegt demnach nicht im Einbezug aller von den Entscheidungen betroffenen Menschen. Die demokratische Errungenschaft kann vielmehr in der Realisierung von Gleichheit unter denjenigen ausgemacht werden, die den Bürgerstatus innehatten. Hier gab es keinen Anlass, Unterschiede unter den Bürgern auszumachen, der den einen für ein Amt mehr befähigt hätte als einen anderen; zumindest was die legislativen und judikativen Organe betrifft. Es waren keine Asymmetrien zwischen Bürgern relevant, denn der Gleichheitsgedanke schloss ein, dass die meisten Ämter potenziell von jedem Bürger ausgeführt werden konnten. Diese Form der Gleichheit unter attischen Bürgern; das ist das demokratische Erbe Athens. Das diesem Gleichheitswert entsprechende Verfahren kann einzig das Los sein, denn eine Wahl kompromittiert das Gleichheitsideal, fußt sie doch immer auf einer wahrgenommenen Überlegenheit eines Kandidaten gegenüber einem anderen, wie das vor allem der Politikwissenschaftler Bernard Manin in seinem Buch Kritik der repräsentativen Demokratie herausstellte.
An diesem Punkt sei also festgehalten: Los und Demokratie konnten seit dem antiken Griechenland gar nicht getrennt voneinander betrachtet werden. Mit dieser wertvollen Erkenntnis bestärkt, hätte die Demokratiegeschichte eigentlich einen anderen Lauf nehmen müssen. Mit dem Aufkommen der großen Demokratien der Neuzeit, gepaart mit dem populär gewordenen Universalitätsgedanken der Aufklärung, der zumindest in der Theorie allen Menschen eine gleich geartete Vernunft bescheinigte, hätte es lediglich zur breiteren Anwendung von Wahllotterien kommen müssen. Denn schließlich war „nur“ der Umfang an Menschen gewachsen, die politische Teilhaberechte wahrzunehmen verlangten; ausgehend von mehreren Tausend Bürgern Athens zu Millionen Staatsbürgern der jungen amerikanischen Demokratie im 18. Jahrhundert.
Aber es kam anders. Die Gründerväter der Vereinigten Staaten, die den Siegeszug der Demokratien der Neuzeit maßgeblich vorantrieben, entschieden sich für ein Verfahren, das bisher nur in adligen Kreisen Anwendung fand: das Wahlverfahren. Und gaben dies wiederum dreisterweise als demokratische Errungenschaft aus. In den maßgeblichen Schriften, den Federalist Papers, äußert sich James Madison folgendermaßen: „Who are to be the electors of the federal represantatives? Not the rich, more than the poor; not the learned, more than the ignorant; […]. The electors are to be the great body of the people of the United States.“ Welche Farce! Das niedrigschwellige Angebot, wählen gehen zu können, wurde als Realisierungsbeweis von Gleichheit aufgefasst. Das viel entscheidendere sogenannte passive Wahlrecht folgte aber in keinem Fall einem beschworenen Gleichheitsideal. Hier meine ich die Möglichkeit, sich als Kandidat aufstellen zu lassen. Besonders der renommierte Autor David Van Reybrouck wies in seinem Buch Gegen Wahlen auf diese Fehlentwicklung hin.
Die Folge waren in großer Mehrzahl vermögende Parlamentarier, die ihre Karriere mit einem politischen Amt abzurunden wussten. Sehr reiche Männer, deren Selbstwertgefühl sich auf Basis ihrer Wählerschaft, der sogenannten „Constituents“, ins Unermessliche steigerte. An diesem Punkt der Geschichte war das goldene Kalb, diese Antithese der „demokratischen Wahl“ geboren; Wer von nun an die Wahl ablehnte, galt als unrealistisch oder gar demokratiefeindlich. Denn die tückische Konsequenz der Abschaffung der Wahl liegt auf der Hand: Letztlich steht der Feind des Elektoralen dafür ein, vielen Bürgern das niedrigschwellige Angebot der Stimmabgabe zu nehmen.
Kollektives Magenverderben
Doch werfen wir einen Blick auf die heutige Zeit. Aus der Perspektive der deutschen Demokratie ließe sich durchaus entgegnen, dass sich tatsächlich alle Bürger zur Wahl aufstellen lassen können. Die Kandidatur ist nicht mehr vordergründig an ein großes Vermögen gekoppelt wie in den USA des 18. Jahrhunderts. Ein Blick in die Lebensläufe der gegenwärtigen Politiker dieses Landes offenbart ein zumindest heterogenes Bild. Sind damit nicht alle Gleichheitsdefizite passé? Mitnichten. Die klassistische Trennung zwischen gewählten Vermögenden auf der einen und wählenden Armen auf der anderen Seite wurde durch eine scheinbare Professionalisierung der Politik ersetzt. Politik wurde zum Beruf und ein Bewerber bedurfte nun wie auf dem Arbeitsmarkt bestimmter Fähigkeiten, die ihn zu einem guten Parlamentarier machten. Anders gesagt: Kandidaten müssen – gerade in einem Wahlkampf, der in Zeiten von digitalen Massenmedien geführt wird – authentisch vorweisen, dass sie über relevante Eigenschaften verfügen, die es für ein politisches Amt vermeintlich braucht. Und hier beginnt dieser auch als Bestenauslese bekannte, vermeintliche Vorteil der Wahl in Absurdität umzuschlagen.
Diejenigen, die nun im Sinne Max Webers an eine sachliche Leidenschaft, Verantwortungsgefühl und ein distanziertes Augenmaß des Berufspolitikers appellieren, sei gleich entgegnet, wie sie im politischen Auswahlprozess aus der Ferne denn solche Charaktereigenschaft bei Kandidaten erkennen bzw. vorausahnen können? Besitzen sie dafür einen sechsten Sinn? Wenn dem so ist, scheint dieser am Tag, an dem Donald Trump gewählt wurde, kollektiv ausgefallen zu sein. Es können keine einheitlichen Rationalitätsmaßstäbe, die einen Politiker ausmachen sollten, Bestand haben. Ansonsten läge ein Amtseignungstest viel näher. Zudem ist die Stimmabgabe ein dermaßen kontingentes Phänomen, das der demokratische Wert des Verfahrens gegen Null geht. Wo liegt der Wert im willkürlichen und aus der Magengrube entschiedenen Ankreuzen auf einem Wahlzettel? Wollen wir vor jeder wichtigen Abstimmung weiterhin kollektive Bauchschmerzen ob eines fatalen Ausgangs erleiden? Betrachtet man allein die Ängste vor den Ergebnissen der kommenden US-Präsidentenwahl ergibt sich ein fatales Bild: Ein einziger Wahltag, ein einziges Kreuz hat unabsehbare globale Folgen.
Den Neubeginn wagen
Wir müssen uns dem Ideal der Gleichheit annähern, das im antiken Athen vorherrschend war; nur eben ausgeweitet auf alle Gruppen, die eine politische Entscheidung betreffen könnte. Jeder Mensch ist zum politischen Entscheiden fähig, er muss nur in einen angemessenen, nicht-emotionalisierten Kontext eingebettet werden. Es bedarf der Auslosung von Bürgern, die sich im Gespräch mit anderen Bürgern repräsentativ mit den politischen Fragen unserer Zeit beschäftigen. Es bedarf der Begleitung durch Experten der politischen Entscheidung und des nachhaltigen Austauschs untereinander. Es bedarf nichts anderem als der Deliberation. Heißt aber auch: Politik muss langweilig werden; für die Medien nahezu uninteressant, damit so viele wichtige Themen nicht schon in der Medienlandschaft verzerrend vordiskutiert werden. Dann sind Bürger zu erstaunlichen Ergebnissen fähig, die sich als effizient und stabilitätsgenerierend zugleich erweisen werden. Es gibt zahlreiche Unterstützer des Losverfahrens, die inspirierende Konzepte entworfen haben: Hélène Landemore, David Van Reybrouck, Hubertus Buchstein, Terry Bouricius usw. Es gibt aber auch zahlreiche Experimente in der politischen Praxis, die umfassenden Erfolg gehabt haben.
Es bedarf also einer wahrlich revolutionären Reform des Auswahlverfahrens von Repräsentanten und nicht nur einer kleinlichen Auseinandersetzung über fehlenden und teuren Platz für zu viele Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Dieser Neubeginn sollte gewagt werden; gerade angesichts der Möglichkeiten einer digitalen Zeit. Es bedarf dafür lediglich des politischen Mutes. Das Credo sollte lauten: Weniger wählen gehen, mehr Lotto spielen. •
Weitere Artikel
Moralischer Fortschritt im Bauch
In seinem neuen Buch geht Thomas Nagel der Frage nach, wie es zu moralischem Fortschritt kommt. Eine Lesenotiz von Hendrik Buchholz.
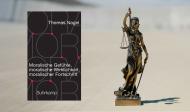
Brauchen wir massive Betschemel?
Gegen die unablässige Selbstbespiegelung und den damit einhergehenden medialen Narzissmus elektronischer Sozialprogramme von Facebook et al. scheint kein Kraut gewachsen. Zwischen Twitternden und Pinteressierten rückt der private Raum unaufhaltsam ins Öffentliche, jeder Eintrag ein Bekenntnis, jede Nachricht gleicht einer öffentlichen Beichte, die Widerhall findet im unüberschaubaren Echoraum diffuser Mitleser- und Zuhörerschaften.
Martin Luther und die Angst
Sein kultureller Einfluss ist nicht zu überschätzen: Martin Luthers Bibelübersetzung bildet den Anfang der deutschen Schriftsprache, seine religiösen Überzeugungen markieren den Beginn einer neuen Lebenshaltung, seine theologischen Traktate legen das Fundament einer neuen Glaubensrichtung. In der Lesart Thea Dorns hat Luther, der heute vor 479 Jahren starb, die Deutschen aber vor allem eines gelehrt: das Fürchten. Oder präziser: die Angst. In ihrem brillanten Psychogramm des großen Reformators geht die Schriftstellerin und Philosophin den Urgründen von Luthers Angst nach – und deren uns bis heute prägenden Auswirkungen.

Katharina Wicht: „Redefreiheit bedeutet auch, sich von inneren Zensuren freizumachen“
Katharina Wicht hat 2022 den Parrhesia Verlag für Philosophie und Belletristik gegründet. Im Interview erzählt sie von ihrer „edition Schatten“, mit der sie den Werken Aufmerksamkeit schenken will, die sonst nicht beachtet werden.

Reinhard Merkel: „Die Idee des olympischen Sports muss reformiert werden“
Am Freitag begannen die Olympischen Spiele 2024 in Paris, wobei sich am regulativen Prinzip der Wettkämpfe seit der Antike nichts geändert hat. Noch immer gilt: Schneller, höher, weiter! Dabei erzwingen neue biotechnische Möglichkeiten der Körperoptimierung eigentlich ein Umdenken, meint der Rechtsphilosoph Reinhard Merkel.

Schluss mit Talent
Talentierte Menschen verdienen besser, ernten mehr Anerkennung und verkörpern das innerste Prinzip der Leistungsgesellschaft. Doch handelt es sich bei näherem Hinsehen um ein unhaltbares Konzept, das nicht nur ungerecht ist, sondern auch Individuen in die Verzweiflung treibt. Höchste Zeit, es abzuschaffen.

Cass Sunstein: „Das Leben gleicht über weite Strecken einer Lotterie“
Unsere Entscheidungen treffen wir unter permanenten Störgeräuschen, meint der Verhaltensökonom und einstige Berater Barack Obamas Cass Sunstein. Im Interview erläutert er, warum der Faktor Zufall oft unentdeckt bleibt und wie wir unsere Entscheidungsqualität dennoch verbessern können.

Lea Ypi: „Der Kapitalismus verstößt gegen das kantische Prinzip“
Ist die Verwirklichung von Freiheit eine Sache des Einzelnen oder der Gesellschaft? Die Philosophin Lea Ypi betont, dass es auch in unterdrückenden Verhältnissen eine unveräußerliche Verantwortung des Menschen gibt. Dennoch muss die Gesellschaft so reformiert werden, dass sich unser moralisches Potenzial entfalten kann.

Kommentare
Das könnte eine gute Idee sein, so scheint auch mir. Sie in einer der größten demokratischen Gesellschaften zu versuchen scheint mir aber zu riskant. Falls zwei Landesparlamente oder zwei ähnlich situierte Parlamente anderer Länder dieses Repräsentationsverfahren erfolgreich realisiert haben, scheint es mir eher vertretbar, es im Bundestag zu versuchen.
Ich danke für die Möglichkeit, zu kommentieren.
Faszinierender Vorschlag! Und gelungener Appell. Das sollte erwogen werden. Nur WO solche Dinge erwägen?
(1) Ich schlage vor: komplexe moderne Gesellschaften brauchen ein Meta-Organ, welches die politische Struktur als solches reflektiert und ggfls. Justierungen vorschlägt, die allerdings im Ernstfall dem Volk als Ganzes zur Wahl gestellt werden müssten. Denn in welcher ART von Staat wir leben wollen, kann nur das Volk als Ganzes entscheiden. Hier kommt man um Direktwahl nicht herum.
(2) Um sicher zu gehen: Gleichheit der Bürger ist ein Postulat, keine Tatsache. Und sie lässt sich wohl nur in verschiedenen Hinsichten realisieren. Eine Wahl-Demokratie (repräsentative Demokratie) realisiert Gleichheit in Hinsicht auf das Stimmrecht. In einer Los-Demokratie bestände Gleichheit in Hinsicht auf die Möglichkeit, politischer Entscheider zu werden.
(2.a) Die höchste Gleichheit erreicht Direktdemokratie, die durch eine "Staats-App" heute problemlos umsetzbar wäre (hinreichende IT-Sicherheit vorausgesetzt!). Aber Direktdemokratie hat Nachteile. Direktdemokratische Entscheider setzen sich unter Umständen nicht hinreichend mit Entscheidungen auseinander, da sie quasi zwischen Tür und Angel entscheiden (was durch digitale Abstimmung noch verstärkt würde). In dem von Hendrik Buchholz stark gemachten Losverfahren wäre dieser Nachteil behoben. Ausgeloste Entscheider würden tatsächlich lokal zusammenkommen, um mit hinreichend Zeit und politischer Beratung in Diskussion zu treten.
(2.b) Los-Demokratie scheint vor allem den Vorteil zu haben, parteipolitische Komponenten aus der Politik zu entfernen. Viele Bürger sind frustriert, weil sie den Eindruck haben, dass Parteien (und Politiker) um sich selbst kreisen. Das Losverfahren würde größere Sachlichkeit in die Politik bringen. Für ausgeloste Entscheider ginge es nicht darum, eine Partei zu vertreten, sondern die richtige Entscheidung zu treffen. So sollte Politik sein.
(3) Ich stimme A. Schmidts Kommentar vom März 2023 zu. Es wäre wünschenswert, wenn Los-Demokratie zuerst in Ländern wie Luxemburg, den Niederlanden oder Schweden getestet würde. Andererseits hat aber Deutschland, wie keines dieser Länder, eine Geschichte mit unterschiedlichsten Staatsformen. Wir sind erfahren mit Systemwechseln...