Der Preis der Freiheit
Sanktionen gegen Russland haben den Wohlstand der Bürger zur Bedingung. Warum wir uns gerade jetzt am republikanischen Ideal materieller Potenz orientieren müssen. Ein Essay von Oliver Weber.
„Wir können auch einmal frieren für die Freiheit. Und wir können auch einmal ein paar Jahre ertragen, dass wir weniger Lebensglück und Lebensfreude haben. Eine generelle Delle in unserem Wohlstandsleben ist etwas, das Menschen ertragen können.“ – Können sie das wirklich? Diese Rückfrage blieb aus, als der ehemalige Bundespräsident in einer Talkshow im März auf die Frage antwortete, ob Deutschland Russland aufgrund dessen Angriffs auf die Ukraine mit einem Öl- und Gas-Embargo belegen sollte. Joachim Gauck votierte für den Wert der Freiheit, auch gegen alle drohenden ökonomischen Kosten und sozialen Widerstände. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker, so die Maxime, ist höher zu gewichten als materieller Gewinn. Hier drang plötzlich ein Freiheitsverständnis in den Vordergrund, das viele Jahrzehnte in Vergessenheit geraten war: die politische, republikanische Freiheit des Citoyen, gegen die das Privatinteresse des Bourgeois im Zweifelsfall zurückstehen muss. Doch ein Blick in die Ideengeschichte zeigt: Diese Freiheitsidee hat ökonomische Voraussetzungen, die Liberalen wie Gauck kaum geheuer sein dürften.
Die republikanische Idee der Freiheit zielt auf politische Machtausübung ab. Sie stellt sich eher nicht schützend vor die Privatsphäre, die Unternehmensfreiheit, die Individualrechte der Bewohner eines Landes, sondern will sie vielmehr zur Partizipation ermutigen. Politik, so die Grundannahme, ist wichtiger als private Lebensfreude. Wer sich aus dem Raum der Öffentlichkeit zurückzieht (oder ihn gar nicht erst betritt), der ist kein wirklich freier Mensch, sondern jemand, der nur auf das Eigene hinauswill und das Gemeinsame missachtet. Dieses republikanische Paradigma ist sehr alt – aber gerade heute gewinnt es erneut viele Verfechter. Nicht nur, wenn über ökonomische Sanktionen gegenüber Aggressoren wie Russland gestritten wird. Philosophen wie Michael Sandel oder Philip Pettit haben daraus in den letzten 20 Jahren eigene Theorien geschmiedet, die sie als Zeitdiagnosen und Lösungsmodelle auch einer breiten Öffentlichkeit anbieten.
Besitz und Teilhabe
Wirft man einen Blick auf die ideengeschichtliche Tradition des Republikanismus, stößt man allerdings immer wieder auf ein Hindernis, das das idealistische Pathos ausbremst: Wir werden den „Menschen frei nennen, der um seiner selbst willen, nicht um eines anderen willen ist“, heißt es etwa bei Aristoteles in der Metaphysik. Dieser Freiheitsbegriff wird in der Schrift Politik so konkretisiert, dass bestimmte Menschengruppen aus ihm herausfallen: „Die beste Polis aber wird keinen Gewerbsmann zum Bürger machen, und sollte auch er ein Bürger sein, so ist doch die von uns angegebene Tugend des Bürgers“ nur denen zuzuschreiben, „die von dem Erwerb des notwendigen Lebensunterhalts befreit sind“. Bürger im Sinne aktiver Teilhabe an der Herrschaft der Polis, soll das heißen, kann nur sein, wer materiell wohlhabend genug ist, das heißt wer wirtschaftlich von keinem anderen abhängt und Muße genug hat, an der Öffentlichkeit teilzunehmen.
Wer wäre von dieser Einschränkung betroffen gewesen? Wohl der Großteil der Bewohner des damaligen Athen: Sklaven, Kinder, Frauen, Fremde, Gesinde und Knechte, Tagelöhner, arme Bauern, Handwerker, Krämer und Händler, Geldverleiher. Alle Schichten also, die entweder aus „natürlichen“ Gründen als minderwertig gelten, für jemanden arbeiten oder einer Tätigkeit nachgehen, die auf den bloßen Geldgewinn aus ist und folglich nicht der Autarkie dient. Unabhängig und damit politikfähig ist eigentlich nur, wer hinreichend großen Acker besitzt, den er auch größtenteils nicht selbst bestellen muss. Unnötig zu sagen, dass der Kreis an Personen, die heute gemäß aristotelischer Kriterien infrage kämen, noch viel kleiner ausfallen würde.
Blinde Flecken
Politik setzt in der alteuropäischen politischen Philosophie, die von der Antike an bis über das Mittelalter hinaus ihre Wirkung entfaltet, Herrschaft voraus: Herrschaft über einen „Oikos“, eine „Familia“, ein „Ganzes Haus“ (Otto Brunner) – von dort her bezieht der polisfähige oder gemeindefähige Mann die Mittel und die Berechtigung, Teil der politischen Gemeinschaft zu sein. Man hat dieses „Herrschaftsproblem“ (Manfred Riedel) oft übergangen und ausgeblendet. Beliebt ist etwa die voreilige Bemerkung, Autoren wie Aristoteles seien eben in ihrer Zeit verhaftet gewesen und deswegen noch unfähig, eine allgemeine Menschengleichheit zu denken. Heute, so der kühne Schluss, ist eben jeder zur Politik fähig und sollte politische Rechte ausüben. Das Pathos des Neorepublikanismus unserer Tage kommt genau hierher: aus der Notwendigkeit, eine soziale Einschränkung zu verdecken, die für den Republikanismus vergangener Jahrhunderte noch gegolten hat.
Das Beispiel, das Joachim Gaucks Forderung abgibt, im Zweifelsfalle auch mal für die Freiheit zu frieren, zeigt, dass man es sich damit womöglich zu leicht macht: Muss, wer eine folgenreiche Entscheidung trifft, diese Folgen nicht auch ökonomisch erst mal tragen können? Die Überlegung, die hinter der sozialen Beschränkung des vormodernen Freiheitsbegriffes steht, ist kein bloßes Vorurteil privilegierter Schichten. Im Gegenteil: In der Ideengeschichte hat sich eine Reihe von Argumenten versammelt, die diese Einschränkung rechtfertigen. Aristoteles begründete sie etwa damit, dass ein Mensch, der seinen Geist auf die materielle Selbsterhaltung oder den ökonomischen Geldgewinn richtet, keine Tugend ausüben kann. Seine Ziele widerstreben einem Zusammenleben gleichberechtigter Bürger. In der römischen Tradition finden wir ähnliche Argumente: Cicero schreibt in De officiis, dass letztlich nur die freien Berufe und die Landwirtschaft „eines Freien würdig“ seien, weil nur sie zur geistigen Unabhängigkeit führen und dem Gemeinwohl dienen – so erklärt der Historiker Sallust den Untergang der römischen Republik aus der Luxusneigung der Oberschichten, die korrupt gemacht habe.
Diese republikanische Tradition ist in der Antike nicht abgestorben. Sie vermittelt sich im Mittelalter über die Auffassung, dass nur ein fehdeberechtigter Edelmann, der einem Herrenhaus vorsteht, landrechtlich zum Handeln befähigt ist. Und sie reicht bis zu den amerikanischen Gründervätern. John Adams deklamierte 1776: „Der menschliche Charakter ist so schwach, dass sehr wenige Menschen ohne Eigentum eigene Urteilskraft besitzen. Sie reden und stimmen nach Anweisung eines Begüterten“. Auch auf dem Kontinent ist das Argument im 18. Jahrhundert bekannt. Jean-Jacques Rousseau schreibt 1762 im Contrat social: „Du willst also dem Staat Dauerhaftigkeit verleihen? – bringe die Extreme so weit wie möglich einander näher: dulde weder Überreiche noch Bettler. Diese beiden Stände, natürlicherweise gekoppelt, sind dem Gemeinwohl gleicherweise verderblich; aus dem einen kommen die Helfershelfer der Tyrannei, aus dem anderen die Tyrannen“. Immanuel Kant, selbst begeisterter Rousseau-Leser, schreibt 1793: „Die erforderliche Qualität“ eines Bürgers mit Stimmrecht ist, dass „er sein eigener Herr sei, mithin irgendein Eigenthum habe, welches ihn ernährt“.
Selbstständigkeit als Ressource
Die Reihe ließe sich lange fortsetzen. Fasst man die Begründungen zusammen, so ergibt sich, dass bis in die frühe Moderne hinein dem Eigentum eine bestimmte geistig-politische Kraft zugeschrieben wurde. Dazu muss man verstehen, dass unter „Eigentum“ nicht jedweder Reichtum fiel, sondern eben nur derjenige Besitz, der den Besitzer materiell zu einem gewissen Grad selbstständig machte. Wer nur auf sich angewiesen ist, der kann sich ganz dem Gemeinwohl widmen – wer abhängt von der Bezahlung oder Ernährung durch andere (oder davon, unbegrenzt Reichtümer anzuhäufen), der ist korrumpierbar und läuft also Gefahr, das Eigene über das Gemeinsame zu stellen. Hinter dem, was dem heutigen Neorepublikanismus allzu oft als bloßes soziales Vorurteil erscheint, steht also ein politisch-ökonomischer Nexus, der die Vernünftigkeit und Tugendhaftigkeit des politischen Raumes garantieren soll.
Dementsprechend nehmen sich auch die frühliberalen Reformversuche aus, die seit dem späten 18. Jahrhundert Wirkung entfalteten: Nicht jeder war dabei so radikal wie Rousseau, der die Rückkehr in eine kleinräumige Subsistenzwirtschaft von Kleinbauern forderte, um seine Republik zu etablieren. Johann Gottlieb Fichte plädierte dafür, das Eigentumsrecht unter die Bedingung eines allgemeinen Rechtes auf Arbeit zu stellen und so materielle Sicherheit und Freiheit gleichermaßen zu schützen. Für Kant reichte es aus, wenn alle feudalen Schranken beseitigt wurden, damit wahrscheinlich war, dass immer größere Teile der Staatsbewohner ein kleines Eigentum erwerben und sich damit zu Staatsbürgern hocharbeiten. John Adams wollte die Geografie der Neuen Welt nutzen, „um das Land in kleine Einheiten aufzuteilen, damit die Massen Grundbesitz erwerben können“. Gemeinsam war ihnen die Idee, dass eine allgemeine Republikanisierung der Gesellschaft, das Ende von Feudalismus und Königsdespotie, nur über eine Verbreiterung der Eigentümerbasis erreicht werden könne.
Die Entwicklung, die die Gesellschaft seit dem 19. Jahrhundert genommen hat, spricht diesen Reformversuchen Hohn. Statt materieller Selbstständigkeit für immer größere Bevölkerungskreise sind nun so gut wie alle sozialen Schichten marktabhängig geworden. Sie sind angewiesen auf Jobs, regelmäßiges Einkommen oder die Erwirtschaftung eines gewissen Profits. Gleichzeitig wurde etwa das Wahlrecht immer mehr Personen zuteil. Man könnte also von einer Demokratisierung ohne ökonomische Selbstständigkeit sprechen – um jenen Sachverhalt auf den Punkt zu bringen, der uns normal vorkommt, den republikanische Denker vor dem 19. Jahrhundert aber paradox genannt hätten. Es ist leicht einzusehen, dass die Rückkehr in eine aristotelische Autarkie oder amerikanische Farmergesellschaft utopisch ist.
Zeiten des Umdenkens
Interessant ist aber die Frage, ob das Argument, das hinter dieser Vorstellung stand, nicht ununterbrochene Geltung besitzt. Warum schreckt man etwa lange davor zurück, einen Staat wie Russland so zu sanktionieren, wie es der Völkerrechtsverletzung, die von ihm begangen wurde, entsprechen würde? Deswegen, weil Industrieverbände um ihre Produktionslinien bangen und Politiker berechtigterweise Angst vor sozialem Widerstand haben, wenn sich die Strom- und Spritpreise plötzlich verdoppeln. Warum verfährt man mit der Bekämpfung des Klimawandels so zaghaft, wenn es um einschneidende Maßnahmen geht? Weil sie Geld und Jobs kosten könnten – von denen nicht wenige abhängig sind, wie man etwa an den Gelbwesten-Demonstrationen in Frankreich sehen konnte.
Der Preis, den wir für die Gleichzeitigkeit von Marktwirtschaft und Demokratisierung bezahlen, ist, dass der Raum des politisch Möglichen durch die Gesetze von Kapitalakkumulation und Einkommensströmen begrenzt wird. In Krisenzeiten, wenn etwa ein Entzug der ökologischen Grundlagen abgewehrt oder ein angreifender Staat geschädigt werden muss, wird diese Aporie nur besonders sinnfällig. Verstärkt wird das Problem dadurch, dass die soziale Ungleichheit seit den 1980er Jahren in beinahe allen westlichen Ländern enorm zugenommen hat. Das heißt im Lichte des alten Republikanismus: Die Abhängigkeit der unteren Schichten hat sich massiv verstärkt.
Doch Krisenzeiten sind auch immer Zeiten des Umdenkens. Es wäre viel gewonnen, wenn es möglich wäre, die Erfahrung, einem Aggressor wie Russland ausgeliefert zu sein, in das politische Projekt zu überführen, nicht nur die Energielieferanten zu diversifizieren, sondern auch die westlichen Gesellschaften resilienter zu machen. Das alteuropäische Ideal der Selbstständigkeit mag ein Ideal bleiben, aber die Orientierung an ihm würde einem Projekt wie diesem die nötige Tiefe geben, um die politische Handlungsfähigkeit westlicher Bürgerschaften zu garantieren. – Freilich muss man dann bereit sein, auch den Preis geringerer Markteffizienz und geschrumpfter Profite zu entrichten. •
Oliver Weber hat Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre in Mannheim und Demokratiewissenschaft an der Universität Regensburg studiert. Er schreibt unter anderem Essays und Rezensionen für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die ZEIT und den Merkur. Aktuell bereitet er eine Promotion zur Ideengeschichte des politischen Eigentumsbegriffs im frühen Liberalismus vor.
Weitere Artikel
Nach der Arbeit
KI droht, Arbeitsleistung radikal zu entwerten und damit unsere Quelle für Wohlstand und Würde zunichtezumachen. Doch zugleich steckt in der Technik das Potenzial für ein freies Leben ohne Lohnarbeit. Es kommt darauf an, die Weichen richtig zu stellen und herauszufinden, woraus Wohlstand und Würde in Zukunft erwachsen können.

Wie viel Gleichheit verträgt die Freiheit?
Die Fortschrittserzählung, dass alle vom Wohlstand profitieren, wird zunehmend porös. Ist also mehr Staat gefragt? Oder steht der Einzelne in der Pflicht? Die Politologin Ulrike Ackermann und der Soziologe Oliver Nachtwey über das richtige Verhältnis von Umverteilung und Selbstbestimmung
Oliver Percovich: Der Antifragile
Der Umgang mit Unwägbarkeit ist sein Leben: Der Skater Oliver Percovich begeisterte Kinder in Krisengebieten für seine Leidenschaft – und machte einen Beruf daraus. Begegnung mit einem, der verfallene Städte in eine Halfpipe verwandelt.

Andreas Weber: „Ein Kompromiss ist ein wilder Friede“
Kompromisse haben einen schlechten Ruf. Sofort wittert man Übervorteilung und Betrug. Eine ganz falsche Sichtweise meint der Philosoph Andreas Weber in seinem jüngst erschienenen Buch „Warum Kompromisse schließen?“. Im Gespräch erläutert er, warum wir diese Form der Übereinkunft als Ausweis unserer Menschlichkeit schlechthin betrachten sollten.

Madisons Albtraum
In Die Unvereinigten Staaten zeichnet Stephan Bierling ein dunkles Bild der aktuellen Lage: Durch parteipolitische Spaltung droht das Ende jener Republik, die die Gründerväter ersonnen haben. Oliver Weber fragt sich in seiner Lesenotiz, wie sich die amerikanische Demokratie neu erfinden kann.
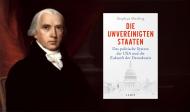
Staatskörper
Mit der bevorstehenden Berufung der Juristin Amy Coney Barrett an den US-amerikanischen Supreme Court erhoffen sich viele Konservative eine Verschärfung oder gar Aufhebung des Rechts auf Abtreibung. Darin offenbart sich exemplarisch eine tiefe Widersprüchlichkeit der Republikanischen Partei, die sich sonst vehement gegen staatliche Eingriffe in die private Lebensführung stellt. Bei den amerikanischen Konservativen verbinden sich nämlich zwei Denktraditionen, die eigentlich nicht zusammengehen.

Die womöglich Letzte ihrer Art
Die Lockerung der Schuldenbremse ist entschieden, der Weg für ein Sondervermögen von 500 Milliarden für Investitionen in Klimaschutz und Infrastruktur ist frei. Der Druck auf die nächste Bundesregierung ist hoch, diese Chance zu nutzen, meint Oliver Weber.

Die Pflicht, seinem Land zu dienen
Die Einführung einer Dienstpflicht widerspricht dem liberalen Selbstverständnis, das den Schutz vor staatlicher Übergriffigkeit und das Recht auf freie Entfaltung hochhält. Bei näherem Hinsehen aber ist wahre Selbstverwirklichung nicht möglich ohne verpflichtende Rückbindung an eine Gemeinschaft. Ein Plädoyer von Leander Scholz. Einspruch erhebt Oliver Weber.
