Die Philosophie von „The Boss“
Was hat der berühmte US-Rockstar Bruce Springsteen mit der Mystikerin Simone Weil und dem Schriftsteller Ralph Waldo Emerson zu tun? Anlässlich des gerade laufenden Biopics Deliver Me from Nowhere lohnt ein Blick in die Philosophie des Rockstars.
Philosophie Magazin +

Testen Sie Philosophie Magazin +
mit einem Digitalabo 4 Wochen kostenlos
oder geben Sie Ihre Abonummer ein
- Zugriff auf alle PhiloMagazin+ Inhalte
- Jederzeit kündbar
- Im Printabo inklusive
Sie sind bereits Abonnent/in?
Hier anmelden
Sie sind registriert und wollen uns testen?
Probeabo
Weitere Artikel
Emerson und das Selbstvertrauen
Ralph Waldo Emersons philosophische Überlegungen gelten als „intellektuelle Unabhängigkeitserklärung“ der USA. Sein berühmtester Essay Self-Reliance ist ein emphatisches Plädoyer für Eigenständigkeit und Individualismus. Doch diese Forderung ist komplexer, als sie auf den ersten Blick scheint.

21. Türchen
Von der Neuerscheinung bis zum Klassiker: In unserem Adventskalender empfiehlt das Team des Philosophie Magazins bis Weihnachten jeden Tag ein Buch zum Verschenken oder Selberlesen. Im 21. Türchen: Unsere Redakteurin Theresa Schouwink rät zu Nature and Selected Essays von Ralph Waldo Emerson (Penguin, 416 S., 13,22 €)

Nora Bossong: „Ich hoffe, dass diese Generation eine Brücke baut zwischen den Boomern und der Klimajugend“
In ihrem heute erscheinenden Buch Die Geschmeidigen zeichnet Nora Bossong ein politisches Porträt ihrer Generation. Ein Gespräch über Angepasstheit, den „neuen Ernst des Lebens“ und vernünftige Visionen.

Yves Bossart: „Lachen ist Aufklärung“
Humor ist eine Weltanschauung, schreibt Yves Bossart in seinem neuen Buch. Wir haben mit ihm über Komik im Krieg, das Ende der Angst und ein Leben in der Schwebe gesprochen.

Byung-Chul Han: Sprechen über Gott
In seinem neuen Buch Sprechen über Gott denkt Byung-Chul Han mit der französischen Mystikerin Simone Weil noch einmal neu über Themen nach, die ihn seit langem beschäftigen – etwa der allgemeine Verfall der Aufmerksamkeit sowie die Bedeutung der Schönheit und des Schmerzes. Wer sich auf das Buch einlässt, erfährt Wesentliches über unsere Gegenwart und Wege, die zu Gott führen.
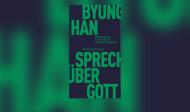
Simone Weil: Das Leid der anderen
In ihrem Lebensvollzug war Simone Weil radikal und setzte sich einer selbst gewählten Entwurzelung aus. In ihrer Philosophie befasst sie sich hingegen intensiv mit dem Bedürfnis nach Wurzeln.

Orwell und die Überwachung
„Big Brother ist watching you“, kaum ein Satz ist so tief in unser politisches Bewusstsein eingedrungen wie die Kernbotschaft aus George Orwells dystopischem Roman „1984“. Mit großer Eindringlichkeit und Präzision schildert Orwell in diesem Werk den Alltag in einer totalitären Überwachungsgesellschaft. Kein Wort bleibt hier unbelauscht, keine Geste ungeprüft, kein Gedanke folgenlos. Mit den digitalen Informationstechniken, die im Zeichen von Big Data unseren gesamten Alltag protokollieren und erfassen, hat Orwells Vision vom totalen Überwachungsstaat neue Aktualität gewonnen. Kurz nach der Amtsübernahme von Donald Trump schnellte das Buch in den USA sogar zurück auf die Bestsellerlisten, aus konkreter Angst vor einer neuen Ära des Freiheitsverlusts und der Wahrheitsferne. In seinem Essay untersucht der Philosoph Bruce Bégout, wie Orwells Idee zu dem Buch entstand. Im Vorwort zum Beiheft geht Éric Sadin dem Phänomen der globalen Überwachung nach.
Simone Weil und die Verwurzelung
Für die französische Philosophin Simone Weil war die „Verwurzelung“ ein Fundamentalbedürfnis der Seele. Diese ist jedoch keineswegs konservativ zu verstehen. Vielmehr vermag der Mensch sich durch sie von äußerer Herrschaft zu emanzipieren.
