Dune: grüne Science-Fiction ohne Technik?
Im Jahr 1965 startete Frank Herbert seine Romanreihe Dune, die zu einem der erfolgreichsten Science-Fiction-Klassiker aller Zeiten avancierte. Derzeit läuft eine neue Filmadaption des Stoffs im Kino. Wird sie der brillanten Vorlage gerecht?
Achtung! Der folgende Text verrät Teile der Handlung.
Einer der wichtigsten Protagonisten von Dune ist Dune selbst. Ein Wüstenplanet dessen Oberfläche lebensfeindlicher kaum sein könnte, in dessen Untergrund sich allerdings die überaus begehrte Ressource „Spice“ befindet. Eine Substanz, die das Leben enorm verlängert, die kognitiven Fähigkeiten steigert und für interstellare Reisen notwendig ist.
Im Zentrum der Handlung, die sich um diesen Wunderrohstoff entspinnt, steht die adlige Familie der Atreides unter Führung von Herzog Leto (Oscar Isaac). Letzterer nämlich wird mitsamt seiner Sippe von höchster Stelle nach Dune beordert, um dort künftig den Spiceabbau zu überwachen. Eine Aufgabe, die früher das Adelsgeschlecht der Harkonnen ausübte – so zumindest scheint es zunächst. Denn die Harkonnen, brutale Kriegsherren, die vom schrecklichen Baron Wladimir (Stellan Skarsgård) beherrscht werden, sind noch immer auf Dune stationiert und Teil eines mörderischen Komplotts gegen die Atreides.
Was sich im ersten Moment wie ein standardmäßiger Science-Fiction Plot anhört, wendet Regiesseur Denis Villeneuve dreifach – dramaturgisch, technisch-religiös sowie im Hinblick auf kommende Klimakatastrophen – und macht den Film so zu einem intellektuellen Genuss.
Adlig ins Chaos schlingern
Erstens ist Dune aus rein erzählerischer Perspektive sehenswert, da man Helden selten so ungeschützt ins Chaos laufen sieht. Schon der Name der Atreides, der an das verfluchte Geschlecht der Atriden in der griechischen Mythologie angelehnt ist, verheißt nichts Gutes. Wo wir uns durch Blockbuster wie Star Wars an Figuren gewöhnt haben, die selbst den fruchtbarsten Situationen mit mittlerer Anstrengung entkommen, begleiten wir die Atreides schlingernd auf ihrem Kurs ins Chaos. Nichts scheint die Verschwörung gegen sie noch aufhalten zu können.
Dass die Wüste der perfekte Ort ist, um diese menschliche Verzweiflung zu veranschaulichen, wird deutlich, wenn selbst die mutigsten Schritte wortwörtlich im Sande verlaufen und die Hitze die letzten Kräfte verdampft. Außerdem gibt es ja auch noch die gigantische Sandwürmer, die so mächtig sind, dass sie von den einheimischen Bewohnern namens Fremen als Götter verehrt werden. Gibt es überhaupt irgendeine Hoffnung zwischen Hitze, Staub und gottgleichen Würmern?
Von Robotern und Religion
Die zweite Dimension, die Dune aus der weiten Landschaft mittelmäßiger Science-Fiction herausragen lässt, ist die überraschende Nichtigkeit von Technologie. Frank Herbert schrieb die ersten Dune-Romane als die Verehrung der „Hard-Science“ ihren Zenit bereits überschritten hatte und man dem technisch-wissenschaftlichen Fortschritt nicht mehr die Lösung sämtlicher Probleme zutraute. Dieser von Ernüchterung geprägte Zeitgeist spiegelt sich auch in der Filmadaption wider. Wir sehen eine Welt, aus der sämtliche „Denkmaschinen“ vertrieben worden sind. Lange vor den Ereignissen im Film haben die Menschen aus Angst vor der Unterdrückung durch Roboter einen Krieg gegen diese geführt. Das Ziel: Die Zerstörung sämtlicher künstlicher Intelligenz (KI) inklusive dem Gebot, dass niemand eine Maschine erschaffen darf, die dem menschlichen Geist ähnelt.
Als Folge dieses Krieges entstanden zahlreiche mystische Orden mit außergewöhnlichen Kräften, etwa die Mentaten. Letztere sind ein Volk hochleistungsfähiger Strategen und Mathematiker, die die Aufgaben übernommen haben, die früher Maschinen erledigten. Ebenfalls zentral für den Film sind die Bene-Gesserit. Bei ihnen handelt es sich um einen matriarchalischen Orden, der im Verborgenen genetische Selektionen durchführt, um einen Messias zu schaffen. In Dune nehmen Religion und Technik also die je gegenteilige Rolle ein, die ihnen die Genrekonvention eigentlich zuschreibt. Technologie findet praktisch nicht statt. Religion hingegen ist überaus wichtig. In Dune ersetzt keine denkende Maschine Gott, sondern umgekehrt ist es die Religion, die die Leere füllt, welche die Zerstörung der KI hinterlassen hat.
Klimawandel: Im eigenen Saft
Drittens macht Dune sehenswert, dass es sich bei diesem Film vielleicht um den ersten Science-Fiction Blockbuster handelt, der die ökologische Frage wirklich ernst nimmt. Den Sorgen seiner Zeit weit voraus, zeichnete Herbert bereits in den 70er-Jahren einen Planeten, auf dem Umweltzerstörungen zu einer Knappheit von Ressourcen führen könnten, die zu einem konstanten Kampf um Leben und Tod führen. So ist beispielsweise Wasser auf Dune so kostbar, dass die Fremen Ganzkörperanzüge tragen, die Schweiß und Urin aufbereiten und sie so in der brennenden Hitze vor dem Verdursten schützen.
Zudem ist Dune aber auch deshalb ein Film über die Klimakatastrophe, weil er den Planeten als geschlossenen und fragilen Kreislauf zeigt. Mehrfach wird von jenen Charakteren betont, die mit der Überwachung des ökologischen Gleichgewichts beauftragt sind, dass jeder noch so kleine Eingriff Auswirkungen auf das gesamte Funktionieren hat. Dune ist mehr als die Summe seiner Teile, als wäre er ein höheres Wesen, ein lebender Organismus.
Gaia als Wüste
Der Gedanke, Planeten als eine Art Superorganismus zu fassen, der erstmals in Isaac Asimovs Buch Der Tausendjahresplan von 1942 auftauchte, wurde 1979 von James Lovelock aufgegriffen und durch dessen Buch Gaia als „Gaia-Hyptothese“ einer breiteren Öffentichleit bekannt gemacht. Für ihn ist die Erde ein „einziges gigantisches lebendes System“, in dem „die Luft, der Ozean und der Boden viel mehr als eine einfache, von lebenden Organismen unabhängige Umgebung sind: Sie sind selbst Teil des Lebens. Luft ist für das Leben, was das Fell für die Katze oder das Nest für den Vogel ist.“
Interessanterweise kam Lovelock diese Idee nach eigener Aussage durch „die Eroberung des Weltraums“ und „die Wiederentdeckung der Erde, die sie ermöglichte“. Der Anblick dieser prächtigen, blau-weiß gesprenkelten Kugel habe uns alle begeistert. Eine Entrückung also, die im Umkehrschluss dazu führt, dass unser ökologisches Bewusstsein geschärft wird. In diesem Sinne ist es einer der großen Trümpfe der Science-Fiction im Allgemeinen und von Dune im Besonderen darauf aufmerksam zu machen, dass wir diesen Planeten in seiner gesunden Gestalt vermissten, würden wir ihn zerstören. Gehen wir es an. •
Weitere Artikel
Eingeholte Fiktionen – Science-Fiction und das kollektive Déjà-vu
Science-Fiction ist zu einem relevanten Werkzeug der Gegenwartsbetrachtung avanciert. Das wird besonders daran sichtbar, dass ihre Vorhersagen zunehmend von aktuellen politischen und technologischen Entwicklungen eingeholt werden.

Muskismus – ein Universum für Superreiche
Die reichsten Männer der Welt treiben ihre Geschäftsmodelle auf die nächste Stufe. Sei es durch die geplante Besiedlung des Mars oder die Erschaffung einer virtuellen Realität. In dieser Art des extraterrestrischen Extremkapitalismus scheinen Börsenkurse weniger von Profiten als von Science-Fiction-Fantasien getrieben zu sein. Dumm nur, dass Elon Musk, Mark Zuckerberg & Co. die von ihnen bewunderten Science-Fiction-Autoren offensichtlich radikal missverstanden haben.

Ursula K. Le Guin – Science-Fiction als Philosophie
Am 22. Januar 2018 verstarb die Sci-Fi- und Fantasy-Autorin Ursula K. Le Guin. Ihr Werk erhob das lange verpönte Genre des Science-Fiction zur philosophischen Hochliteratur. Und verlieh ihm feministische Kraft.

Donna Haraway: „Wir müssen lernen, mit dem Mehr-als-Menschlichen in Kontakt zu treten“
Donna Haraway inspirierte Generationen dazu, neue, kreative Arten der Koexistenz von Mensch, Natur und Technik zu entwerfen. Ihr Denken bewegt sich zwischen Thomas von Aquin, Science-Fiction und Hundetraining. Eine Begegnung unter Bäumen.
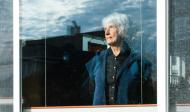
Wie Science-Fiction zur Philosophie wurde
Der Philosoph Gotthard Günther und der Soziologe Arnold Gehlen analysierten das Verhältnis von Mensch und Maschine – und sahen in alltäglicher Technik die Vorboten künstlicher Intelligenz.

Karl Bartos: „Im ‚Caligari‘ geht es um das Verschwinden der Wirklichkeit“
Der expressionistische Stummfilmklassiker „Das Cabinet des Dr. Caligari“ ist ein Meilenstein der Kinogeschichte. Nun legt der Ex-Kraftwerk-Musiker Karl Bartos eine Neuvertonung des Stoffs vor. Was ihn dazu gebracht hat, erläutert er im Interview mit Florian Werner.

Ruben Östlund: „Jeder Film verändert die Welt“
Ruben Östlund, zweimaliger Gewinner der Goldenen Palme bei den Filmfestspielen von Cannes, beweist mit jedem seiner Filme seine Vorliebe für Gedankenexperimente. Der Regisseur von Triangle of Sadness, der derzeit in den Kinos läuft, spricht mit uns über seine Inspirationsquellen, seine philosophischen Einflüsse und sein Verständnis von Kunst.

Herbert Marcuse (1898–1979)
Unbeugsamer kritischer Denker, Idol der Studierendenproteste von 1968: Herbert Marcuse schaffte es wie kein anderer seiner Kollegen, sein kritisches Denken mit politischem Aktivismus in Einklang zu bringen. Seine Werke faszinieren durch ihren utopischen Gehalt und durch ihr Drängen auf die Befreiung der Gesellschaft von den Zwängen des Kapitalismus
