Überwindung als Versprechen
Die schillernde Vorsilbe „Trans-“ zielt mit einem Gelübde an die Überwindung des Alten ins Offene. Sie will in luftige Höhen gelangen und nicht zurückblicken. Dabei scheut sie sich, so Dieter Thomä, auch nicht vor Experimenten und Ekstase.
Dieter Thomä ist ein Pionier der Prefix Studies. Seine wöchentliche Reihe über Avant-, Anti-, Re-, Ko-, De-, Dis-, Neo-, Spät-, Trans-, Meta-, Post- ist gleichzeitig der Countdown zu seinem Buch Post-. Nachruf auf eine Vorsilbe, das im März bei Suhrkamp erscheint.
Lesen Sie hier die bisherigen Texte der Reihe: „Avant-“, „Anti-“, „Re-“, „Ko-“, „De- und Dis-“ sowie „Neo- und Spät-“.
Trans-
Die Vorsilbe „Trans-“ ist im Verlauf ihrer langen, bewegten Geschichte Beziehungen zu wechselnden Partnern eingegangen. Der Bogen reicht von „Tradition“ („trans“ + „dare“), „Transzendenz“, „Transparenz“, „Übersetzung“ („translation“), „Übertragung“ („transference“), „Transgression“, „Transformation“ über „Transkulturalität“ und „Transhumanismus“ zu „transnational“, „transversal“, „transsexuell“, „transsektional“ und auch zu einer Zeitschrift namens „Transmodernity“.
Die historische Konjunktur dieser Vorsilbe zeigt zu keinem Zeitpunkt eindeutig nach oben oder unten. So wirkt zum Beispiel die Berufung auf Tradition ewiggestrig, ist aber unverwüstlich und kommt immer wieder hoch, egal ob die christlichen Werte des Abendlands, der American Creed oder die lokalen Traditionen in von der Globalisierung bedrohten Kulturen verteidigt werden. Dabei steht das Wort „Tradition“ nicht einfach für Rückwärtsgewandtheit, sondern für Bestandspflege, also für die Übertragung von Inhalten aus der fernen Vergangenheit in die vertraute Gegenwart.
Falle der Offenheit
Die Botschaft von „Trans-“ besteht insoweit darin, dass sich etwas durchzieht oder durchdringt. Diese Botschaft steckt auch in der Transparenz, die – jedenfalls in der Politik – dem Zweck dient, für Durchsicht und Durchblick zu sorgen. Dabei ging es im 18. Jahrhundert bei Jeremy Bentham vor allem um die ungehinderte Kontrolle der Untertanen in einer Gesellschaft, während heute das Stichwort der gläsernen Regierung für die Kontrolle von unten steht. Wer transparent agiert, vollführt eine Art geistigen Striptease. Manche meinen, diese totale Offenheit stehe im Dienste der Moral. So glaubt Mae, Mitarbeiterin der titelgebenden Firma The Circle in dem dystopischen Roman von Dave Eggers, dass sie ein besserer Mensch werde, wenn sie ihr Leben „transparent“ mache und sich bei jedem ihrer Schritte von zahllosen „Viewern“ beobachten lässt. Das geht schief.
Eine dynamische Schwester von Tradition und Transparenz ist die Transformation. Hier geht es nicht nur um die Übermittlung von Inhalten, sondern um einen Umbau oder um eine Umformung. Diese Wortverbindung taucht an prominenter Stelle im Titel von Karl Polanyis großem Buch The Great Transformation von 1944 auf, in dem es um die kapitalistische Totalverwandlung der Welt geht, aber man kennt sie auch aus der eher technokratisch operierenden Transformationsforschung in der Soziologie. Manchmal ist bei einer Umformung oder Verwandlung gar nicht klar, wie das Schlussbild aussieht. Dann steht die Vorsilbe „Trans-“ für eine Bewegung ins Offene. Die Wortverbindungen, die dieser Bewegung frönen, sind zurzeit besonders erfolgreich. Drei Beispiele: „Transsexuell“ ist schicker als „bisexuell“, „Transnationalität“ und „Transkulturalität“ haben das Internationale und Interkulturelle ausgestochen, und der „Transhumanismus“ erhält größeren Zulauf als der „Posthumanismus“. Für diese „Trans-“Punktsiege scheint das Versprechen der Öffnung eine Schlüsselrolle zu spielen. Anders als Bisexualität will Transsexualität ein binäres Schema hinter sich lassen. Während die Vorsilbe „Inter-“ Beziehungen zwischen abgeschlossenen Einheiten herstellt, verspricht Trans- deren Überwindung. Und die Transhumanisten wollen nicht nur den Menschen hinter sich lassen, sondern ein Wesen unbegrenzter Möglichkeiten erschaffen.
Zum „overman“ werden
Die Mutter dieser Gesten ins Offene ist die Überschreitung oder Transgression, die von Georges Bataille und Michel Foucault gepriesen und betrieben worden ist. Und die Großmutter ist die Überwindung, die Friedrich Nietzsche in die Philosophie eingeführt hat. Er lässt Zarathustra sprechen: „Zehn Mal musst du des Tages dich selber überwinden: das macht eine gute Müdigkeit und ist Mohn der Seele.“ Wer diese Selbstüberwindung praktiziert, ist auf dem besten Weg, ein Übermensch zu werden. Dieser ist von Nietzsche freilich nicht so konzipiert worden, dass er über den Menschen erhaben wäre, sondern soll ebenjenen Menschen bezeichnen, der sich ständig überwindet. In den englischen Nietzsche-Übersetzungen ist man deshalb längst dazu übergegangen, den „Übermenschen“ nicht mehr als „superman“, sondern als „overman“ zu übersetzen.
Der wichtigste philosophische „Trans-“Begriff ist zweifellos die „Transzendenz“. Er ist deshalb lehrreich, weil hier die Bewegung, die „über“ etwas hinausführt, mal nach oben und mal nach vorn führt. Für die Bewegung nach oben steht die Transzendentalphilosophie Immanuel Kants, in der die Kategorien, die uns bei der Erkenntnis leiten, aufgeklärt werden. Mit der Transzendentalphilosophie haben die Mitglieder des amerikanischen Transzendentalismus, also Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau und andere, wenig zu tun. Sie befinden sich bei ihrer Überschreitung nicht auf dem Weg nach oben, sondern auf dem Weg nach vorn und nehmen Nietzsches Idee der Selbstüberwindung vorweg. Emerson schreibt 1841: „Das Eine, was wir mit unstillbarem Verlangen suchen, ist, uns selbst zu vergessen und einen neuen Kreis zu ziehen.“
Anders als die Vorsilbe „Anti-“ verhakt sich die Vorsilbe „Trans-“ nicht im Gegner, sondern will ihn abschütteln. Wie die Vorsilbe „Re-“, so ist auch Trans- der Aktion oder dem Prozess zugetan. Wer sich daran stört, muss sich an Martin Heidegger halten, der in seiner Spätschrift Zeit und Sein empfohlen hat, beim Umgang mit der „Metaphysik“ „vom Überwinden abzulassen“ und sie „sich selbst zu überlassen“. Diese Empfehlung entspricht dem Wechsel von „Trans-“ zu „Post-“, denn damit wird das – wie auch immer irreführende – Signal gesetzt, man gehe nicht mehr nur über etwas hinaus, sondern erreiche einen Punkt, an dem man alles hinter sich lassen kann. Dagegen bleibt „Trans-“ in Bewegung. •
Aktueller Tabellenplatz: gehört zur Spitzengruppe
Wichtige Leistungsträger: Transzendenz, Transformation, Transgression
Besondere Eigenschaft: immer in Bewegung
Dieter Thomä ist emeritierter Professor für Philosophie an der Universität St. Gallen und lebt in Berlin. Mitte März erscheint bei Suhrkamp sein Buch „Post-. Nachruf auf eine Vorsilbe“.
Weitere Artikel
Kulturanzeiger – Dieter Thomä: „Post-. Nachruf auf eine Vorsilbe“
In unserem Kulturanzeiger stellen wir in Zusammenarbeit mit Verlagen ausgewählte Neuerscheinungen vor, machen die zentralen Ideen und Thesen der präsentierten Bücher zugänglich und binden diese durch weiterführende Artikel an die Philosophiegeschichte sowie aktuelle Debatten an. Diesmal im Fokus: Post-. Nachruf auf eine Vorsilbe von Dieter Thomä, erschienen bei Suhrkamp.
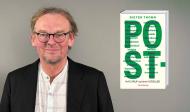
Endlich am Ende?
Die Vorsilben „Neo-“ und „Spät-“ springen ins Feld, wenn Begriffe dem Abdanken nahe kommen. „Neo-"will nicht ganz Abschied nehmen und versucht sich auf eine Revitalisierung des Alten und „Spät-“ zögert das unweigerliche Ende ins Unendliche aus, erläutert Dieter Thomä.

Paul-Philipp Hanske: „In der Ekstase blitzt die Möglichkeit einer belebten Welt auf“
Seit jeher nutzen wir Pflanzen, um uns in andere Bewusstseinszustände zu versetzen. Der Soziologe Paul-Philipp Hanske, selbst ein Freund der Ekstase, erläutert im Interview, warum die Geschichte unserer Spezies eng mit psychoaktiven Pflanzen verwoben ist.

Hängengebliebene Revolutionäre?
Vorsilben verraten mehr über politische Programme und philosophische Systeme, als deren Urhebern lieb sein mag. Dieter Thomä stellt die Mitglieder der ersten Liga der Vorsilben vor. An der Spitze rangiert „Post-“.

Dieter Thomä: „Die USA laufen Gefahr, sich in zwei gänzlich parallele Gesellschaften zu entwickeln“
Viele der Kriminellen, die am 6. Januar das Kapitol stürmten, inszenieren sich als Helden. Der Philosoph Dieter Thomä erläutert, warum sie genau das Gegenteil sind, die Demokratie aber dennoch „radikale Störenfriede“ braucht.

Dieter Thomä: „Wenn Soldaten Helden sind, dann zweiten Ranges“
Seit Beginn des Ukrainekriegs sind sie wieder in aller Munde: Helden. Der Philosoph Dieter Thomä erläutert, warum auch Demokratien Helden brauchen, die Gleichsetzung mit Soldaten aber problematisch ist.

Helene Bubrowski: „Die Politik ist von archaischen Verhaltensmustern geprägt“
Die Fehlerkultur ist in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zu einem hohen Gut avanciert. In Ihrem Buch Die Fehlbaren illustriert Helene Bubrowski, inwiefern der offene Umgang mit den eigenen Schwächen auch im politischen Betrieb gewinnbringend wäre. Ein Gespräch über die Schwäche, vor den eigenen Fehlern allzu oft die Augen zu verschließen.

Dieter Thomä: "Keine Demokratie ohne Störenfriede!"
Was tun, wenn man sich fremd in der eigenen Gesellschaft fühlt? Gar eine radikal andere Welt will? Fragen, die im Zentrum des Denkens von Dieter Thomä stehen. Ein Gespräch über kindischen Lebenshunger, gestörte Männer und die tödliche Sehnsucht nach totaler Ordnung.