Was macht uns mutig?
Nr. 66 - Oktober/November 2022
Wer mutig handelt, weiß nicht, wie die Sache ausgeht. Viel kann auf dem Spiel stehen, Glück, soziales Ansehen, gar das Leben. Was bringt uns dazu, das Risiko einzugehen – und uns selbst zu übertreffen?
Alle Texte in der Übersicht
Arena
Unsinn als Protestform
Was, wenn unser Gegenüber mit Argumenten nicht zu überzeugen ist? US-Aktivisten versuchen Verschwörungstheoretiker nun mit ihren eigenen Mitteln zu schlagen.

Ich chatte, also bin ich
Im Gespräch mit einem Google-Mitarbeiter soll der neu entwickelte Chatbot LaMDA einen Anwalt gefordert haben, um seine Interessen zu schützen.

Die epistemische Falle
Anfang August wurde ein 16-jähriger Geflüchteter von einem Polizisten mit fünf Kugeln aus einem Maschinengewehr getötet. Die Tat löste keine nennenswerte Empörung aus. Der Grund liegt in einem fatalen Fehlurteil mit rassistischer Ursache.

Instagram-Spiritualität: Der neue Geist des Kapitalismus
In den Sozialen Medien feiert eine eklektische Spiritualität ihren Aufstieg. Ein zentrales Thema dieser Bewegung ist Geld, das sich durch die richtige Geisteshaltung magnetisch anziehen lasse. Was sagt das über unsere Gegenwart?

Das Ende des Explosionszeitalters?
Jüngst hat das Europäische Parlament dafür gestimmt, den Verkauf von Neuwagen mit Verbrennungsmotoren ab 2035 in der Europäischen Union zu verbieten. Laut dem Philosophen Peter Sloterdijk bedeutet dies einen zivilisatorischen Wandel.

Der Freihandel als Kriegsstifter
Wirtschaftliche Beziehungen zwischen den Ländern sichern den Frieden: Diese Annahme ist tief in unserer Kultur verankert, doch durch den Angriffskrieg Russlands wurde sie erschüttert. Ein Blick in die Ideengeschichte zeigt, dass sie schon immer umstritten war.

John McWhorter: „Rassismus ist ein extrem überstrapazierter Begriff“
Die identitätspolitischen Kulturkämpfe werden immer unerbittlicher. John McWhorter ist überzeugt: Der neue Antirassismus führt zu einer religiösen Schuld- und Anklagekultur. Armen schwarzen Menschen hilft er hingegen nicht.

Verstehen ohne Verständnis
Politisches Geschick setzt voraus, sich in die Sichtweise des Aggressors hineinzuversetzen, ohne das Verstehen in eine Rechtfertigung kippen zu lassen. Nora Bossong über eine Gratwanderung am Beispiel des Taiwankonflikts.

Leben
Materialität des Geräuschs
Immer mehr Menschen schauen sich Videos an, in denen wohltuende Geräusche abgespielt werden, vor allem menschliche Stimmen. Was verrät das über den modernen Menschen?
Digitale Zweitschöpfung
Gott vollzog seine Schöpfung, indem er Sätze formulierte, die unmittelbar Wirklichkeit wurden.

Barnum-Effekt
Und wieder trifft das Horoskop die eigene Situation punktgenau. Wie kann das sein? Der Barnum-Effekt gibt Aufschluss und liefert zudem eine tröstliche Botschaft.

Wie werde ich weise?
Je mehr Entscheidungen uns abgerungen werden, desto größer wird die Sehnsucht nach einem tiefen Wissen, das uns das Richtige tun lässt: nach Weisheit. Die Kulturanthropologin Aleida Assmann und der Philosoph Michael Hampe ergründen eines der ältesten Konzepte der Menschheit.

Wie wichtig ist Schönheit?
Gut aussehen will fast jeder. Aber welche Bedeutung hat das attraktive Äußere aus philosophischer Sicht?

Sehnsucht nach Indien
Am 15. August feierte die Republik Indien ihren 75. Unabhängigkeitstag. Die Welt ist indes abhängiger denn je vom bald bevölkerungsreichsten Land der Welt. Wie indisch bei uns gefühlt, gedacht und gehandelt wird, zeigt ein Streifzug durch Kultur, Philosophie und Politik.

Die Sache mit dem Schnürsenkel
Der Schnürsenkel soll Halt geben, aber leicht wieder zu lösen sein: Die Schlaufe findet ihre Bestimmung in vorläufiger Permanenz und schult schon kleine Menschen im Autonomiegewinn.

Dossier: Was macht uns mutig?
Traut euch!
In postheroischen Gesellschaften gilt der Mut oft als reine Privatangelegenheit. Mit Hannah Arendt jedoch lässt sich zeigen, dass er gerade in Demokratien die politische Kardinaltugend ist.

Mein Mut
Woher kommt der Mut? Sind es konkrete Situationen? Ideale? Oder tiefes Selbstvertrauen? Eine Lebensretterin, ein ehemaliger Berufssoldat und ein Extremkletterer erzählen.

Übermut tut manchmal gut
Wer sich sträubt, einen zugewiesenen Platz zu akzeptieren, ist übermütig. Dies kann verheerende Folgen haben. Es gibt jedoch Momente, da ist Übermut schön, vernünftig, schöpferisch und sogar eine Pflicht.

Was müssen wir uns zumuten?
Seyran Ateş riskiert für ihren Freiheitskampf ihr Leben. Die Schriftstellerin Thea Dorn ist mit der Frauenrechtlerin befreundet und steht als streitbare Denkerin regelmäßig im Debattenkreuzfeuer. Ein Gespräch über die Mitte zwischen Feigheit und Tollkühnheit.

Klassiker
Günther Anders und die Atombombe
Am 6. August 1945 wurde auf Hiroshima die erste Atombombe abgeworfen. Für Günther Anders zeigt sich angesichts der Nuklearwaffe ein Grundproblem der Menschen: Sie können sich die Folgen ihrer eigenen Schöpfungen nicht mehr vorstellen und leiden deshalb an chronischer Apokalypse-Blindheit. Eine Zukunft hat unsere Welt nur, wenn wir das Fürchten lernen.

Schopenhauer und die Hoffnung
Für Christen ist die Hoffnung eine Tugend. Arthur Schopenhauer hingegen verstand sie als „Verwechslung des Wunsches einer Begebenheit mit ihrer Wahrscheinlichkeit“. Wie ist das zu verstehen? Eine Interpretationshilfe.
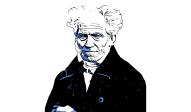
Was ist Mystik?
In unserer Rubrik Auf einen Blick machen wir philosophische Strömungen in einem Schaubild verständlich. Diesmal: Die christliche Mystik, in deren Mittelpunkt die unmittelbare Vereinigung mit einer absoluten, göttlichen Wirklichkeit (lat. unio mystica) steht.

Bücher
Weltumspannend wohnen
Emanuele Coccia erkundet das Zuhause und lässt dabei Materie und Leben, Subjekte und Objekte ineinanderfließen. Seine Korrektur am anthropozentrischen Weltbild stimmt skeptisch.

Denken auf dem Außenposten
Der große Beobachter, Existenzialist und Schamane Werner Herzog wird 80 Jahre alt. Und zeigt in einer jetzt erschienenen Autobiografie, wie eng Filmemachen und Schreiben in seinem Werk verknüpft sind.

Philosophie der Zwischenräume
Was ist Musik? Worin sah Vladimir Jankélévitch ihr Unaussprechliches? Und wie dachte Ludwig Wittgenstein über Harmonik nach? Drei Bücher suchen nach einer Sprache für schwer fassbare Phänomene.

Wenn Computer simulieren
In seiner Kolumne aus der aktuellen Ausgabe widmet sich Gert Scobel dem Buch Tiefen der Täuschung von Anne Dippel und Martin Warnke, die sich fragen, wie Wirklichkeit im digitalen Zeitalter entsteht.

Finale
Die Unkontrollierbaren
Muff Potter loten auf ihrem neuen Album aus, was Freiheit heute bedeuten kann.

Fäden in die Zukunft legen
Spinnen haben einen schlechten Leumund. Die Retrospektive der Künstlerin Louise Bourgeois könnte das ändern.

Kleine Menschen, große Fragen
Oft stellen Kinder nicht nur sehr gute Fragen, sondern haben auch besonders geistreiche Antworten. In unserer Rubrik Phil.Kids widmen sich kleine Menschen regelmäßig den ganz großen Rätseln des Seins. Zum Beispiel: Sind wir unser Körper?

